Tauchreiseführer Korsika
Klicken auf Bilder mit
Hyperlinks erlaubt eine größere Darstellung, retour via
Browserbutton "zurück"
  156 Seiten DIN A4 mit ungefähr 300
Schwarz-Weiß-Abbildungen (Fotos, Karten, Cartoons, Webseiten). 3. neu
bearbeitete Auflage/Edition 2013. Softcover mit farbigem Einband,
Fadenheftung.
ISBN 3-937522-37-1, gebundener Ladenpreis 21,80 €. 156 Seiten DIN A4 mit ungefähr 300
Schwarz-Weiß-Abbildungen (Fotos, Karten, Cartoons, Webseiten). 3. neu
bearbeitete Auflage/Edition 2013. Softcover mit farbigem Einband,
Fadenheftung.
ISBN 3-937522-37-1, gebundener Ladenpreis 21,80 €.
Korsika, die Insel der Schönheit
und des Lichts, der Fels im Meer mit wilden Küsten, schroffen Bergen
und wildromantischen Landschaften, aber auch mit wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Problemen. Unser Thema: die Unterwasserwelt!
Reise- und Tauchtipps zur gesamten Insel. Beschreibungen zu
fast allen deutschen und zahlreichen französischen Tauchbasen, ihre
Tauchplätze, Erfahrungsberichte anderer Taucher,
Adressenverzeichnisse und eine Reisebeschreibung über die erste
Begegnung des Verfassers mit Korsika.
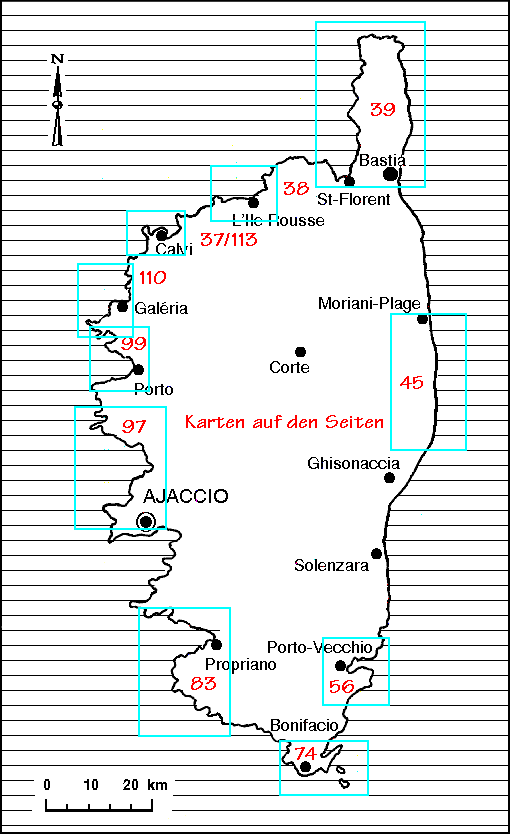 < Zur nebenstehenden Abbildung:
blau umrahmt im
Buch enthaltene Seekartenausschnitte, auf die sich die Tauchbasen- und Tauchplatzbeschreibungen beziehen. < Zur nebenstehenden Abbildung:
blau umrahmt im
Buch enthaltene Seekartenausschnitte, auf die sich die Tauchbasen- und Tauchplatzbeschreibungen beziehen.
Inhaltsverzeichnis | Und als Leseprobe ein Text aus diesem
Tauchreiseführer: Begegnungen
mit Korsika | nach unten
"Tauchen auf Korsika" ist in erster Linie eine Reise- und Tauchplatzbeschreibung und auch ein Tauchbasenführer. Zwar ist eigenverantwortliches Tauchen möglich, doch stehen dem eine Reihe von Schwierigkeiten entgegen wie beispielsweise die Problematik der Logistik (die gesamte Ausrüstung mitschleppen einschließlich Boot und Kompressor) oder das Finden geeigneter Tauchstellen. Rechnet man alle Zeit- und sonstigen Aufwendungen, alle Kosten, Nervenbeschädigungen und Schweißtropfen zusammen - lohnt das für die zwei oder drei Urlaubswochen überhaupt? Für uns Otto Normaltaucher ist folgendes gewiss die einfachste, sicherste und bequemste Lösung: Sich bis zu einer Tauchbasis durchzuschlagen und unbekümmert aller Probleme tauchen bis zum Abwinken. Nicht einmal die persönliche Ausrüstung bräuchte man mitzubuckeln. Diese Bequemlichkeit hat freilich ihren Preis. Aber ob es wirklich teurer wird als wenn man alles selbst organisierte, ist noch die Frage! Der Verfasser gesteht, in seinem Plädoyer für basenorientiertes Tauchen außer der Sicherheit und Bequemlichkeit noch einen anderen Aspekt im Hinterkopf zu haben: den Schutz (nein, nein, nicht den von Tauchlehrerarbeitsplätzen) des Tauchens und der Tauchgebiete. Unkontrolliertes Tauchen verleitet - ach wie leicht sind wir doch verführbar - zu Missbräuchen! Lacht da nicht eine Languste, leuchtet hier nicht ein schönes Schneckenhaus, provoziert dort nicht ein aus dem Grund ragender Amphorenhals? Was macht es schon, wer sieht es denn (wenn nicht der wachsame Tauchguide, besorgt um seine Kundenweide)? Doch die Abwandlung eines Slogans vergangener Zeiten ist wohl mehr denn je gültig: So wie wir heute tauchen, wird morgen die Umwelt und Gesetzgebung sein!
Inhaltsverzeichnis nach unten
nach oben
home
Vorbemerkungen
(8)
Meine erste Begegnung
Ein Reisebericht (9)
Anreise und so weiter . . .
Ein- und Ausreisebestimmungen
(33) - Flugzeug (33) - Kraftfahrzeug (34) - Eigenes Kraftfahrzeug
(34) - Autofähren (35) - Reise-ABC (37)
Tauchen
Tauchbasen (41) -
Schutzgebiete (42) - Boote (43) - Pressluft und Dekokammer (43) -
Jäger und Sammler (43) - Wind (44) - Temperatur und Sicht (44) -
Strömungen (45) - Küste (45) - Und wo tauchen?
(46)
Nordküste
(L’Ile Rousse -
Bastia)
L’Ile Rousse (47)
- Saint-Florent (50) - Cape Corse (52) - Bastia (53) - Tauchplätze:
Golf de Calvi bis Cape Corse (55) - Golfe de Saint-Florent (57) -
Bastia (59)
Ostküste
(Moriani-Plage -
Solenzara)
Village de
Vacances (61) - Ghisonaccia (65) - Solenzara (65) - Tauchplätze
Ostküste (66)
Südostküste
(Porto Vecchio -
Palombaggia)
Porto-Vecchio (69)
- Punta di a Chiappa (74) - Plage de Palombaggia (76) - Tauchplätze Südostküste
(77)
Südküste
(Bonifacio - Lavezzi)
nach unten
nach oben
home
Bonifacio (81) -
Tauchplätze Südküste (83) - Taucherschiffe (86)
Südwestküste
(Roccapina - Porto Pollo)
Roccapina (89) -
Einige Tauchplätze (89) - Campomoro (91) - Einige Tauchplätze (95) -
Propriano (96) - Tauchplätze im Golfe de Valinco (98) - Porto Pollo
(99) - Tauchplätze um Porto Pollo (100)
Westküste
(Ajaccio - Porto)
Porticcio (101) -
Ajaccio (103) - Calcatoggio (106) - Sagone (107) - Porto (110) -
Einige Tauchplätze (112) - im Golfe de Lava und Sagone (113) - im
Golf de Porto (114) - im Golf de Girolata (116)
Nordwestküste
(Galéria -
Algajola)
Galéria (117) -
Argentella (119) - Revellata (119) - Calvi (121) - Sant Ambroggio
(123) - Algajola (124) - Tauchplätze (125) - im Golfe de Galéria
(126) - im Golfe de Calvi (128)
Taucher berichten . . .
Vereinsfahrt Seepferde Unna,
Mai/Juni 2006, M.S. Galiote, Tauchschule Tropica, Centre de Plongée
du Golf de Porto (129)
Literatur- und
Quellenverzeichnis
(133)
Tauchbasenverzeichnis
(137)
Register
Orte, Landschaften,
Seegebiete, Tauchplätze (145)
Unsere Publikationen
(149)
Bestellung per E-Mail Ihre
Anschrift bitte nicht vergessen! Ihre
Anschrift bitte nicht vergessen!
nach unten
nach oben
home
Begegnungen mit Kosika
Korsika -
Macchia -
Mittelmeer -
L'Ile Rousse -
Argentella -
Seeigel -
Wachsrosen -
Fototechnik
-
Tintenfische -
Seegurken -
Meeresverschmutzung
- Calvi
-
Golfe de Porto
- Ota bis Solenzara
-
Wirtschaft,
Familie und Politik
-
Bonifacio
-
Lavezzi
- Gorgonien
-
Zackenbarsche
- Ajaccio
-
Am Pfeilerfelsen
-
Röhrenwürmern
-
Tauche nie alleine!
-
Schwämme
- Muränen
- Sammler
-
Die Tage
schwinden
-
Au revoir,
Korsika
Im Jahr 1980
bekam der Verfasser erstmals die Gelegenheit, jene (relativ) engen
Grenzen zu verlassen, die der Sozialismus „seinen“ Bürgern gesetzt
hatte. Er wollte diese Chance weidlich nutzen: Mittelmeer, Karibik,
Rotes Meer! Letzteres hatte dann leider nicht und erst acht Jahre
später geklappt. Aber wie auch immer: Mittelmeer hieß für den
Verfasser Frankreich, dem Geburtsland des sportlichen Tauchens - und
Frankreich wiederum endete für ihn zunächst in Korsika und dann (man
befand sich ja immer noch in Frankreich ...) in seinen
Überseedepartements Guadeloupe und Martinique! Viva la France.
Viele Wochen
später und wieder daheim (mit diversem Ärger, es kostete aber
natürlich nicht den Kopf!) sann der Verfasser noch lange, wie er all
das Geschaute einordnen könne und was ihm besser gefallen hatte: das
exotische Ambiente mit Palmen, dunkelhäutigen Menschen, einer
Segeljacht und warmen Wasser, in dem bunte Fische in bizarren
Korallenstrukturen spielten oder Korsika mit seinen Küsten, Bergen
und Schluchten, mit all den herben bis wildromantischen Landschaften
- und auf jedem Foto das tiefblaue Meer und zugleich irgendwo im
Hintergrund oder am Bildrand immer auch einen Höhenzug oder einen
Felsabhang. - Das Urteil ist immer noch nicht gefällt!
* * *
Brav und
zuverlässig knattert der Trabant durch die Rhôné-Alpen und dann im
Rhônetal hinab nach Süden. Der Regen bleibt in den Bergen zurück. In
der Provence, hinter Avignon, ist es plötzlich wieder Sommer. Am
Abend des 18. Oktober erreiche ich in Marseille den südlichen Rand
Europas: das Mittelmeer.
Die
Tauchbasen an der Côte d'Azur haben bereits geschlossen -
Saisonende! Deshalb entscheide ich mich, vor den anderen Arbeiten in
Marseille, zunächst die südlichste und damit wärmste Provinz
Frankreichs aufzusuchen: Korsika. Aus Tauchsportzeitschriften weiß
ich von einer bis Mitte November geöffneten Basis in L'Ile Rousse;
auch besäße Korsika neben einer herrlichen Landschaft die schönsten
Tauchgründe Frankreichs. Das nächste Schiff nach Korsika fährt am
Montagabend. Zwei Tage verbringe ich ruhelos zwischen Marseille und
Toulon. Es gelingt mir nirgendwo - außer an seichten Badestränden -
zu einem ersten Erkundungstauchgang ins Wasser zu gelangen. Jedes
Fleckchen Küste, das ich ansteuere, ist bebaut, eingezäunt, mit
Verbotsschildern als Privatbesitz gekennzeichnet. Als böse
Überraschung erweisen sich auch die horrenden Autobahngebühren. Und
schließlich stresst der für einem Ostler ungewohnte höllische
Verkehr, besonders in Toulon und Marseille. Obwohl Marseille: der
alte Hafen ist äußerst sehenswert! Die Nacht vor der Abfahrt
schlummere ich am Hafen in einer Parknische in der Nähe des
Fährschiffterminals. Hier harren noch mehrere in ihren PKWs der
kommenden Dinge. Ich bin froh, als am nächsten Tag endlich die Fähre
ablegt. Eine weitere Nacht verbringe ich mehr recht als schlecht im
Liegesessel des Fährschiffs. Als endlich der Morgen aufzieht, ist
die Insel schon in Sicht.
Aus dem Grün
der Insel schimmern rötliche Dächer. Mein Herz klopft
erwartungsvoll. Das vielterrassige Häusermeer Bastias schält sich
aus dem blauen Morgendunst. An Bord kommt Unruhe auf. Ich steige in
die Wagenhalle hinab. Um halb acht klirrt die Fahrrampe auf den Kai.
Zöllner, Hafenarbeiter, Flics und mehrere Zivilisten mit wachsamen
Augen bilden ein Spalier. Auto um Auto rollt an Land, darunter auch
mein IM 22‑59. Es ist Dienstag, der 21. Oktober. Ich bin endlich auf
Korsika!
nach unten
nach oben
Korsika
ist etwa 184 Kilometer lang und bis zu 84 Kilometer breit. Seine
Küstenlinien messen ungefähr 1000 Kilometer. Die Insel besitzt eine
Fläche von 8700 Quadratkilometer. Auf je einen Quadratkilometer
leben im Durchschnitt 26 und in den meisten Regionen der Insel sogar
nur zwei Menschen. Korsika hat ungefähr 230 000 Einwohner, aber nur
etwa die Hälfte von ihnen sind gebürtige und korsisch sprechende
Korsen, die anderen kommen aus Frankreich und aus dem Ausland. In
den siebziger Jahren verließen - meist aus wirtschaftlichen Gründen
- mindestens 50 000 Menschen die Insel.
Die Herkunft
der Ureinwohner Korsikas verliert sich im Dunkel der Vorzeit. Viele
Volksstämme landeten und hinterließen ihre Spuren: Iberer, Ligurer,
Phönizier, Griechen, Etrusker, Syrakuser, Karthager . . . Stets
gelang es den Eroberern und Kolonisatoren nur, wenige Punkte an der
Küste zu besetzen. Die Römer wollten die ganze Insel beherrschen.
Sie kämpften 100 Jahre mit den Bergbewohnern. Im Jahre 162 v. Chr.
hatten sie die korsische Bevölkerung so weit dezimiert, dass Ruhe
eintrat. Die Römer hinterließen ein bis heute erhaltenes
Straßennetz. Sie gründeten die wichtigsten Städte, erschlossen die
Thermalquellen, brachten der Insel das Christentum und die längste
Friedensperiode: 600 Jahre. Im Laufe der darauf folgenden
Jahrhunderte besetzten Vandalen, Goten, Langobarden, Byzantiner,
Mauren und Araber die Insel. 200 Jahre lang stritten sich dann die
Genuesen und Pisaner um Korsika. Genua siegte und erlangte 1284 die
Alleinherrschaft. Viel Freude hatten auch die Genuesen nicht an
ihrem Besitz. Korsika bot lediglich unsichere Siedlungsmöglichkeiten
und Stützpunkte, aber zu holen waren nur Holz, Harz, Bienenwachs und
- die Malaria.
Nun begann
der Unabhängigkeitskampf, die Aufstände gegen genuesische Ritter,
toskanische Grafen, Landadlige der verschiedenen Provinzen und gegen
korsische Tyrannen. Hinzu kamen zahllose Familienkriege, die
Raubzüge der in die Macchia Verbannten, die Vendetta (Blutrache):
eine kaum unterbrochene Folge von Grausamkeiten, Tragödien und
Morden. Es gäbe schon längst keine Korsen mehr, bestünde die Insel
aus flachem Land. So aber flüchteten Bedrohte, Verfolgte, Geächtete
in die Macchia, in die Wälder oder in die unwegsamen Berge. 1768
verkaufte Genua für zwei Millionen Franc Korsika an Frankreich. Die
Franzosen landeten ihre Truppen. Seitdem gilt die Insel als
französisches Departement. In Wirklichkeit ist sie aber stets nur
eines gewesen: korsisch.
nach unten
nach oben
Macchia
Meter um
Meter
laviere ich den Trabant - Stoßstange an Stoßstange - durch das
morgendliche Verkehrschaos von Bastia. Doch bald liegt Korsikas
größte Stadt hinter mir. Die Straße windet sich in die Berge, vorbei
an kleinen Häuschen, Villen, verlassenen und verfallenen Gehöften;
sie schlängelt sich durch Olivenhaine und hügeliges, zerklüftetes
Land. Bizarre Felsketten ragen über den Horizont. Nur etwa vier
Kilometer Luftlinie entfernt vom Hafen erhebt sich der 961 Meter
hohe Pigno. Eukalyptus- und Feigenbäume, fremdartige Gehölze,
riesige Kakteen und vor allem die Macchia bedecken die weiten Hänge.
Die Macchia,
ein fast undurchdringlich ineinander verfizzter Buschwald von halber
bis knapper Manneshöhe, bedeckt über die Hälfte aller Flächen
Korsikas. Macchia besteht überwiegend aus Baumheide,
Erdbeergesträuch, Zistrose, Mastixstrauch, Ginster, wildem Spargel,
Rosmarin und Lavendel. Das eigentümlichste an der Macchia ist ihr
starker aromatischer Geruch. Napoleon erinnerte sich heimwehgeplagt
auf dem unwirtlichen Sankt Helena: „Alles war dort besser, sogar der
Duft des Bodens. Am Wohlgeruch allein würde ich mit geschlossenen
Augen Korsika erkennen.“ Macchia - oder französisch Maquis
geschrieben - bedeutet „Der Undurchdringliche“. Nach ihr benannte
sich auch die französische Widerstandsbewegung.
Schon bald
stoppe ich das Auto. Was für eine wunderschöne Landschaft! der Atem
der Macchia weht durch das weitgeöffnete Fenster. Die über den
Niederungen schwebenden Dunstschleier lösen sich auf. Das milde
Licht des frühen Vormittags enthüllt eine Palette harmonischer
Farben: das Gelb und Ocker herbstlichen Blattwerks, das Grün der
Macchia, das Schwarz verbrannten Gesträuchs, das Weiß und Grau
mancher Felsformation, den rötlichen Ton bestimmter Büsche, Blüten
und Beeren und endlich das vielfältig abgestufte Blau des Meeres.
Thalatta,
Thalatta! Das Meer, das Meer! Wie gut ich jetzt diesen Jubelruf
verstehe. Ihn stießen nach Xenophons „Anabasis“ die von einer
Schlacht (bei Kunaxa 401 v. Chr.) heimkehrenden Griechen aus, als
sie endlich wieder die Gestade ihres heimatlichen Meeres erblickten.
Heines Gedicht „Meergruß“ aus den Nordseebildern verlieh jenem
Freudenschrei eine solche Popularität, dass seine Verwendung als
Zitat bald schon als abgegriffen galt. Aber unablässig, gleich der
verrinnenden Zeit, ändert sich der Wert aller Dinge. Nur die Wellen
furchen unbeirrbar jahraus, jahrein das Mittelmeer, an dessen Küsten
viele hochentwickelte Kulturen seit Jahrtausenden zur Blüte
gelangten und wieder zerfielen.
nach unten
nach oben
Mittelmeer
Der Name
Mittelmeer
bezeichnet eine geographische Lage: in der Mitte zwischen zwei
Kontinenten. Ansonsten ist es Teil des Atlantischen Weltmeeres wie
das Schwarze Meer, die Nordsee und die Ostsee. Viele Monate glüht
die Sonne über dem gleißenden Wasser. Die Sommer sind heiß, die
Winter mild; denn das Mittelmeer liegt im Bereich der Subtropen. Es
fällt kaum Regen. Auch münden hier nur wenige der großen Flüsse.
Strömte nicht ständig Atlantikwasser über die Gibraltarschwelle in
das Mittelmeerbecken, sänke durch Verdunstung der Wasserspiegel
jährlich um ein bis anderthalb Meter. Die große Verdunstungsrate und
die geringe Süßwasserzufuhr erhöhen die Salzkonzentration. In den
Ozeanen beträgt der durchschnittliche Salzgehalt 35 Promille, im
Mittelmeer aber zwischen 36,4 in Gibraltarnähe und 39,2 an den
östlichen Rändern. Der stärkere Salzgehalt vergrößert die
Meerwasserdichte gegenüber dem gleich temperierten Atlantikwasser.
Deshalb fließt in der kalten Jahreszeit unter dem ins Mittelmeer
eindringendem Ozeanwasser ein Tiefenstrom zurück in den Atlantik. So
ist die Gibraltarschwelle gleichsam eine von salzigen Strömen
durchpulste Nabelschnur; sie verbindet die mediterranen Seegebiete
mit den Weltmeeren.
In Richtung
Osten verliert das kalte Atlantikwasser immer mehr an Einfluss. Auch
der Atem des Ozeans, das ewige tägliche Kommen und Gehen von Ebbe
und Flut, schwindet bereits im westlichen Mittelmeer (es reicht von
Gibraltar bis Sizilien) zur Bedeutungslosigkeit. Gegenüber 6 bis
12 Meter an englischen Küsten steigt und fällt hier das Wasser nur
noch um 0,3 bis 0,6 Meter. Die Wassertemperatur erhöht sich dagegen
in östlicher Richtung um einige Grad; im Hochsommer beträgt sie an
der Oberfläche auf der Linie Monaco - Sardinien etwa 25 bis 27 Grad
Celsius und sinkt im Februar ab auf 13 oder 12 Grad Celsius.
Die meisten
Tiere des Mittelmeeres gehören zur Fauna des Atlantiks. Ungefähr 60
Prozent der beispielsweise vor Norwegen lebenden Arten besiedeln
auch das westliche Mittelmeer. Einige Tiere stammen aus tropischen
Regionen, etwa der farbenprächtige Meerpfau. Andere übersiedelten
durch den Suezkanal aus dem Roten Meer. Schließlich zeichnet sich
das Mittelmeer durch eine reichhaltige endemische Fauna aus, also
nur hier lebenden Tierarten. Endemisch sind viele Schleimfische und
ein Viertel aller Stachelhäuter.
nach unten
nach oben
L'Ile Rousse
Ich fahre
weiter
bergan zum 536 Meter hohen Pass Col de Teghime. An der Gedenkstätte
für korsische Patrioten des zweiten Weltkrieges halte ich. Von hier
aus bereiteten korsische Partisanen den faschistischen Truppen 1944
die entscheidende Niederlage auf korsischem Boden. Tagelang feuerte
die Artillerie hinab in den deutschen Brückenkopf, auf die sich in
Bastia einschiffenden fliehenden Soldaten. Mahnend richtet noch
heute ein Geschütz den kalten stählernen Lauf auf die im Morgendunst
verschwimmenden zarten Küstenlinien.
Die Straße
windet sich in Schleifen nun wieder hinab an das Meer, an den
lieblichen Golfe de Saint-Florent. An seiner Küste liegt der Badeort
gleichen Namens, dessen Cathédrale de Nebbio (aus dem 13.
Jahrhundert!) eine dreischiffige Basilika ist. Die Kathedrale gilt
als eines der schönsten sakralen Bauwerke Korsikas. Die Nebbio ist
eine fruchtbare Talbeckenlandschaft um Saint-Florent. Einst nannten
sich die ortsansässigen Bischöfe Grafen de Nebbio; und beim
Zelebrieren der Messen sollen neben den Altären stets geladene
Pistolen gelegen haben.
Um elf Uhr
erreiche ich L'Ile Rousse. Diesen Ort zeichnet ein an der Westküste
Korsikas ganz seltener Vorzug aus: ein feiner Sandstrand. Dadurch
entwickelte sich L'Ile Rousse - in Verbindung mit seinem schönen
Hinterland - zu einem beliebten Fremdenverkehrsort. Jetzt aber ist
der Strand menschenleer. Ein scharfer Wind fegt Sand durch die engen
Gassen. Ich finde weder die gesuchte Tauchbasis noch einen Menschen,
der sie kennt. Alle Leute, die ich mit Unterstützung eines
Zettelchens befrage, sind zwar sehr bemüht, haben aber keine Ahnung.
Ein Korse spricht deutsch. Wir geraten ins Erzählen. Eine Einladung
folgt und schließlich entrinne ich nur mit Mühe einem prächtigen
Gelage.
Die Straße
zwischen L'Ile Rousse und Calvi ist neu und breit. Gleich hinter dem
Ortseingang steht das stattliche zweistöckige Gebäude des
französischen Tauchsportklubs GETS. Was mag das Logis hier kosten?
Finanziell ist für mich eigentlich nur Camping möglich. Noch ehe ich
es recht bedacht und einen Parkplatz gesehen habe, ist die Stadt
schon durchquert. Das nächste mögliche Ziel wäre Argentella, Camp
Morsetta. Da stehen auch schon am Straßenrand schultafelgroße
Aufsteller mit diesem Namen. Je ein stilisierter Taucher und Surfer
werben für mögliche Lustbarkeiten. Also dorthin. Ich bin wieder
guter Laune und rase mit 20 Kilometer/h um die zahllosen Kurven.
nach unten
nach oben
Argentella
Als ich
auf den Zeltplatz einbiege,
steht die Sonne nur noch eine Handbreit über dem Meer. Die Rezeption
und die Bar sind geschlossen. Irgendwo maunzt kläglich eine Katze.
Der Waschraum ist offen. Zugluft raunt im Gebälk der dämmerigen
Halle. Türen klappen. Eine Brause läuft. Ich denke an einen gewissen
Hitchcockfilm und lenke den Wagen hinab an das Meer in offenes,
übersichtliches Terrain. Platz ist ja genug. Das Camp ist absolut
leer.
Die
aufkommende Enttäuschung wird mit einem üppigen Abendessen bekämpft.
Für die Hygiene genügt heute ein Notprogramm. Dann klappe ich die
hintere Sitzbank nach vorn und rolle auf der so entstandenen
Ladefläche Luftmatratze und Schlafsack aus. Um 19 Uhr herrscht
tiefste Nacht. Der Wind frischt auf. Kälte kriecht von den Bergen
herab. Ich schlüpfe unter die Decke und finde schwer Schlaf. Um
Mitternacht stöbern drei Hunde um das Auto herum und entleeren dann
die aus praktischen Erwägungen herangeschleppte Mülltonne.
Der Morgen
dämmert. Gemächlich klimmt die Sonne hinter den Bergketten empor.
Eine Zinne glänzt mit einer Aureole auf. Die Pracht ist von kurzer
Dauer. Schon steigt die Sonne weiter. Ihr Licht fließt hellgelb die
Hänge heran und erreicht endlich auch mich. Ein kaltes Bad?
Frühsport? Ich setze den Benzinkocher in Betrieb. Kaffee! Wieder
einmal siegte die angenehmste Variante der Muntermacher.
Anderthalb
Stunden später wate ich zum ersten Tauchgang durch das feinkörnige
Geröll hinab an das Wasser. Meine Fußspuren haben groteske
Dimensionen. Mutmaßungen, dies stehe in gewissem Zusammenhang mit
einem deftigen Frühstück, sind leicht zu widerlegen. Die
Schuhgröße 48 stammt von den Stiefeln des Tauchanzuges. Von der
augenblicklichen Gesamtmasse mit rund 110 Kilogramm sind nur 58 Kilogram
Körpergewicht, der Rest ist Tauchausrüstung. Ich quetsche die
Stiefel in die Schwimmflossen und stelze rückwärts ins Wasser. Schon
nach wenigen Schritten schwappt es um meine Taille. Ich stecke den
Kopf unter die Oberfläche - gespannt auf all die Wunder warmer
Meere. Ich wundere mich gründlich.
Das Wasser
schimmert blaugrün und ist sehr klar. Die Sichtweite beträgt
mindestens fünfzehn Meter, vielleicht mehr. Zu sehen ist aber fast
nichts! Ein kiesiger Ufersaum, Seeigel und eine sich im Ungewissen
der Ferne auflösende Posidoniawiese, so genanntes Neptunsgras. Ich
bin maßlos enttäuscht! Ich tauche bis zum Hals unter, hebe beide
Arme knapp aus dem Wasser und öffne eine Handgelenkmanschette.
Rauschend entweicht Luft aus dem Tauchanzug. Aber immer noch ist
mein Auftrieb für einen eleganten Abschwung zu groß. Ich plantsche
wie ein Anfänger und bin froh, keinen sachkundigen Zeugen am Ufer zu
wissen. Nur die drei Hunde stehen mit schwer deutbaren Mienen am
Strand.
In
drei Meter Tiefe schwindet die Hektik. Der Wasserdruck hat durch
Kompression der eingeschlossenen Luft und des Anzugmaterials meinen
Auftrieb vermindert. Beruhigend leicht kommt Luft aus dem
Atemregler. An meiner Hüfte baumelt ein mit dem Hochdruckschlauch an
das Tauchgerät gekoppeltes Manometer zur Flaschendruckkontrolle.
Über ein am Tauchanzug montiertes Ventil und einen zur ersten Stufe
des Atemreglers führenden Niederdruckschlauch lässt sich der
Tauchanzug aufblasen wie ein Luftballon. Ein zweites Brustventil
dient zur Anzugentlüftung. So kann ich leicht meinen Auftrieb den
Erfordernissen anpassen. Deshalb heißt das von schwedischen
Berufstauchern entwickelte System „Unisuit“ eigentlich exakt:
Variabel-Volumen-Tauchanzug. Gewöhnlich aber bezeichnet man ihn -
und das ist keine Ironie! - als Trockentauchanzug.
nach unten
nach oben
Seeigel
Die erste
Begegnung
mit der Fauna des Mittelmeeres ist an Küsten mit hartem Untergrund
oft von bestechender Eindringlichkeit - im wahrsten Sinne des
Wortes. Schon stecken in irgendeinem Körperteil Seeigelstacheln.
Bereits in der Nähe des Ufersaumes sehe ich Dutzende von
Steinseeigeln. Sie leben oft dichtgedrängt in Wassertiefen ab einem
halben Meter und bilden so einen gefährlichen Sperrgürtel, als gelte
es, das Meer gegen die Invasion der Zweibeiner zu schützen. Kommt
man den Steinseeigeln zu nahe, werden blitzartig die sonst
beweglichen Stacheln fixiert. Sie dringen in die Haut ein und
brechen ab. Nur mit Geduld, Nadel und Pinzette lassen sie sich
wieder aus der Haut entfernen. In Gesellschaft der Steinseeigel
leben die ähnlichen, aber weniger häufigen Schwarzen Seeigel. Sie
haben längere Stacheln und sind nie bräunlich, sondern immer tief
blauschwarz gefärbt. Ich drehe mit dem Messer einen Steinseeigel um.
Es ist ein schwarzer; das weichhäutige Mundfeld nimmt - im Gegensatz
zu dem wesentlich kleineren des Steinseeigels - die Hälfte der
Körperunterseite ein.
Flossenbewehrt, tauchanzuggepanzert und schwimmend habe ich schadlos
die „Stachelverhaue“ überwunden. Nun, in drei Meter Tiefe, sehe ich
eine andere Seeigelart, eine violette Kugel von Tennisballgröße: den
Violetten Seeigel. Seine kurzen, dichtstehenden Stacheln sind
abgestumpft und zum Ende hin weiß. Ich kann ihn gefahrlos in die
Hand nehmen und seine Unterseite mit dem Kieferapparat betrachten.
Seeigel sind meist Pflanzenfresser; sie weiden Algen von den
Untergründen oder graben organische Bestandteile aus dem Schlick
oder Sand. Seeigel sind stets getrenntgeschlechtlich; sie geben Eier
und Spermien ins freie Wasser ab. Die mikroskopisch kleinen Larven
verwandeln sich nach vier bis sechs Wochen in einen Millimeter große
Seeigel. Die allen Stachelhäuter eigenen Kalkplättchen der Haut
wachsen bei den Seeigeln zu einer festen Schale zusammen. Ich fand
später noch oft die wie ziseliert anmutenden, leicht zerbrechlichen
Körperhüllen. Neben diesen radiär-symmetrischen Seeigeln (Regularia)
gibt es die länglichen, bilateral-symmetrischen Irregularia. Bei
ihnen sind die Stacheln auf pelzige Fasern reduziert. Die
Afteröffnung liegt nicht entgegengesetzt der Mundöffnung (also auf
der Oberseite) wie bei den Regularia, sondern auf der Mundseite. Die
Irregularia, etwa der zwölf Zentimeter lange Violette Herzigel oder
der fünf Zentimeter lange Kleine Herzigel, leben meist im Sand
vergraben. Deshalb fallen nur die hartstacheligen Seeigel auf.
Au! Jetzt
habe ich, beim Aufstützen am Grund, doch einen Steinseeigel
übersehen. Der Stachel lässt sich glücklicherweise mit dem
Fingernagel gleich herausschaben. Ich fotografiere die Seeigel.
Manche von ihnen halten mit ihren Saugfüßen allerlei Pflanzenteile
auf der Körperoberseite fest, vielleicht zur Tarnung, vielleicht als
Schutz gegen zu starken Lichteinfall. Gelegentlich trägt ein Seeigel
- vielleicht ist es gerade der letzte Schick - aus dem Abfall vom
Meeresgrund auch einen Kronenkorken, den Ringöffner einer Bierbüchse
oder er hüllt sich in Grillfolie.
Als ich nach
mehreren Aufnahmen wieder einmal in die Elektronenblitz-Frontscheibe
schaue, um das Aufleuchten der Bereitschaftsanzeige zu beobachten,
sehe ich sofort, dass sie kaum noch lange anzeigen dürfte. Das Gerät
ist zwar ein Unterwasserblitzer, doch Wasser sollte sich eigentlich
nur außerhalb des Gehäuses befinden. Also zurück ans Ufer. Das
Blitzgerät ist schnell demontiert. Ein bisschen Mittelmeer rinnt aus
dem Gehäuse. Ich spüle mit Trinkwasser die elektronischen
Bauelemente und puste größere Tropfen ab. Nötig wäre nun ein
elektrischer Haartrockner, den havariegeplagte Unterwasserfotografen
im Handgepäck haben sollten. Eine Havarie zu haben ist ja kein
Problem, aber einen Föhn? Ich lege das Gerät zum Trocknen auf das
Autodach.
nach unten
nach oben
Wachsrosen
Mit dem
Reserveblitz
und einem Kilogramm zusätzlichem Blei stapfe ich zurück ins Wasser.
Die Seeigel sind nun fast schon alte Bekannte. Der Grund wird
steiniger. Ein „Braunalgenrasen“, durchsetzt mit Trichteralgen,
überzieht manche Blöcke und Flächen. Die erste Wachsrose kommt in
Sicht. Sie ist sicher das auffälligste Tier im Flachwasser an
mediterranen Felsküsten. Sanft schwingen im Rhythmus der Wellen
violett abgesetzte Tentakel. Die Wachsrose ist mit einem Durchmesser
bis zu 12 Zentimeter und maximal 200 bis zu 20 Zentimeter langen
Armen die größte und häufigste Seeanemone des Mittelmeeres. Entgegen
der Angaben vieler Bestimmungsbücher sah ich später zwischen Korsika
und Sardinien öfter noch viel größere Exemplare. Einmal schienen gar
halbmeterlange Tentakel wie gelbliches strähniges Wachs einen Fels
herabzurinnen.
Im Körper
und an den klebrigen Armen der Wachsrose befinden sich unzählige
Nesselkapseln. Bei Berührung explodieren die Kapseln und schleudern
einen mikroskopisch kleinen Injektionsapparat heraus. Das giftige
Sekret lähmt oder tötet die Beute. Sie wird dann mit den Armen in
die Mundöffnung gestopft und in einem einfachen Magen verdaut,
Vorsichtshalber meide ich die Berührung mit der Wachsrose. An der
Hand ist zwar die Haut zu dick, als dass Nesselkapseln sie
durchschlagen könnten. Doch sicher ist sicher!
Ich
fotografiere einen Wachsrosenausschnitt. Für den eingebauten
30-mm-Zwischenring ist das Motiv zu groß. Eine Streifengrundel - für
die wäre meine Kameraeinstellung richtig - sehe ich leider nicht.
Die Streifengrundel lebt gerne in der Nähe von Wachsrosen. Bei
Gefahr kann sie sich unbeschadet zwischen oder unter die ihre Feinde
abschreckenden Tentakel flüchten. Der Schutzstoff in ihrer
Schleimhaut bewahrt die Streifengrundel aber nur vor den
Nesselgiften der Wachsrose. Anderen im Mittelmeer lebenden
Seeanemonen wie der Siebanemone, der Goldrose oder dem
Seemannsliebchen fällt auch sie zum Opfer. Vor Ibiza - die Insel
liegt etwa 800 Kilometer südwestlich von Korsika - beobachtete ich
später eine ganz andere Situation. Da drängelten sich förmlich die
Streifengrundeln unter den hier selteneren Wachsrosen.
Nur langsam
wird der Film voll. Zuletzt fotografiere ich aus Mangel an anderen
größeren Motiven Stillleben mit Algen und Schwämmen. Ich schwimme
recht unzufrieden heimwärts. Tauchzeit 46 Minuten. Maximale Tiefe
sieben Meter. In jedem Trockentauchanzugbein schwappt ein Liter
Mittelmeer.
Am Abend
wird es empfindlich kühl. Ich ziehe mich in das Wohnabteil des
Wagens zurück, also auf den Rücksitz. Dazu: Notizbuch, Grog mit Rum
aus Rostock und eine um Hüften und Beine geschlungene Decke.
Nachdenklich blase ich in die dampfende Tasse. Hatte ich im
Unterbewusstsein - beeinflusst von Bildberichten mit wunderschönen
Drucken - die Farbpalette und Artenvielfalt tropischer Meere
erwartet?
nach unten
nach oben
Fototechnik
In der
Nacht
ist ein ablandiger Wind aufgekommen. Der Morgenhimmel verspricht
leidliches Wetter. Ich wandere zum Ausgang der Bucht. Von dem
berühmten Fotografen Erich Salomo wird erzählt, dass er sich sogar
die Kamera umhängte, wenn er im Hotel nur über den Flur zur Toilette
ging. Salomo fürchtete, unwiederholbare Aufnahmesituationen zu
verpassen. Ihn nehme ich mir zum Vorbild und bewaffne mich auch auf
kleinen Spaziergängen mit der Kamera, einer Pentaconsix mit
Normalobjektiv. Sie befindet sich in einer brotbeutelähnlichen
Schultertasche einschließlich 180-mm-Sonar, Skylightfilter,
Sonnenblende, 30-mm-Zwischenring, Belichtungsmesser, Staubpinsel,
einem kleinen Blitzgerät, Vorsatzlinse, Reservefilmen, Notizbuch und
Kugelschreiber. So habe ich die wichtigsten Utensilien beieinander,
ohne durch vor der Brust pendelnde Apparate oder einen Zubehörkoffer
behindert zu sein.
Am Ende der
Bucht schaue ich zurück: vor mir tiefblaues Wasser, rechts eine
wildbewachsene Uferbefestigung. Drei bis vier Meter tiefer verebben
glucksend kleine Wellen. Links das offene Meer. Dort, wo die See am
weitesten landeinwärts schwingt, am Ufer zart gelb getünchte
Gebäude, umstanden von schönen alten Bäumen. Ein im Morgenlicht
rostroter Strand. Dahinter steilansteigende grüne macchiabedeckte
Hügel. Im Hintergrund zerfurchen Felskämme den Himmel. Ich öffne den
Brotbeutel . . .
Heute steht
nur Tauchen auf dem Tagesplan. Um Druckluft zu sparen - ich besitze
lediglich ein Zweiflaschengerät, aber keinen Kompressor -, als
erstes eine Schnorcheltour: Seeigel, Wachsrosen, Seegurken,
verschiedene kleine Fische - alles keine Beute für meine
weitwinkelbestückte Kamera. Ich mache lustlos einige
Übersichtsaufnahmen. Unterwasserlandschaften ohne lebende Objekte
wie Menschen oder auffällige Tiere wirken meist langweilig,
jedenfalls ist das meine Erfahrung. Weiter seewärts, Tiefe drei
Meter. Das Wasser erscheint glasklar. Ich sehe jedes Detail am
Grund. Ich zucke zusammen. Zwei gelbe Augen - man könnte meinen
Katzenaugen - beobachten mich aufmerksam. Unter einem Stein lugt ein
Krake mit einem sicher nur handgroßen Körper hervor. Ein Winzling
zwar, aber immerhin: mein erster Tintenfisch!
nach unten
nach oben
Tintenfische
sind keine Fische, sondern Weichtiere, Mollusken, wie auch die
Muscheln. Die beiden für Muscheln typischen Schalen verkümmerten
freilich bis auf zwei stabförmige Reste. Der Gewöhnliche Krake, kurz
Oktopus genannt, ist der häufigste Mittelmeertintenfisch, wenigstens
in ufernahen Arealen. Er bevorzugt schlupfwinkelreiche Felsregionen
und Höhlen, nimmt aber auch mit Seegrasfeldern und steinigem
Sandgrund vorlieb. Er gilt als intelligent und baut sich bei
fehlenden Versteckmöglichkeiten selbst Höhlen und Burgen. Eingänge
werden mit Steinen verbarrikadiert. Der Krake ist ein Einzelgänger.
Muscheln und Krebstiere stehen an vorderster Stelle auf seinem
Speiseplan. Seine größten Feinde sind Meeraale, Muränen und
Menschen. Bei Gefahr stößt er eine Tintenwolke aus, um die
Aufmerksamkeit des Angreifers abzulenken; sie beeinträchtigt
vielleicht auch den Geruchssinn seiner Feinde. Viele einheimische
Fischer halten Kraken für eine Delikatesse. Ich mußte einmal kosten
und fand, so ein Stück ähnele im Geschmack und in der Konsistenz
etwa paniertem Radiergummi.
Der kleine
Krake äugt zu mir herauf. Ich linse zum Kraken hinab. Wir belauern
eine Weile. Tintenfische können durch Ausdehnung oder
Zusammenziehung in der Haut befindlicher Farbzellen binnen Sekunden
ihre Färbung ändern. Diese hier trägt momentan den Safarilook.
Schließlich hole ich Luft und plantsche in die Tiefe. Das
Schnorcheln mit dem Unisuit, mit allen Trockentauchanzügen, ist
recht mühsam, aber möglich. Man muss lediglich die Halsmanschette
andersherum krempeln als üblich und sollte nur bis zu einer Tiefe
von drei Meter tauchen. Als ich unten lande, ist der Kraken weg. Ich
suche noch eine Weile das Gelände ab. Vergeblich.
Später dann,
zwischen Korsika und Sardinien, sollte ich noch oft diesen
bemerkenswerten Tieren begegnen. Es erfordert ein wenig Geduld, sie
aus ihren Höhlen zu locken. Kraken sind viel zu ängstlich, um sich
die vom Eingang weggeräumten Steine zurückzuholen und zu neugierig,
nicht beispielsweise ein in knapper Reichweite ihrer Arme abgelegtes
Tauchermesser untersuchen zu wollen. Vielleicht ist das blinkende
Ding brauchbar? Unruhig zuckt der ganze Körper auf und ab wie ein
zappeliges Kind auf der Schulbank, wenn es etwas weiß. In rascher
Folge wechselt seine Färbung. Ein Arm schiebt sich tastend aus dem
Loch. Ein zweiter folgt, der Kopf . . . Ich wage kaum zu atmen. Bloß
keine hastige Bewegung. Sie ließe sich leicht als Angriff werten und
könnte das Tier erschrecken. Zögernd verlässt der Krake seine
Behausung. Vorsichtshalber bleiben so lange wie möglich immer noch
einige Arme in der Höhle.
Aber nicht
nur vor ihren Schlupflöchern konnte ich Kraken beobachten und
fotografieren. Ich sah sie Felswände entlang hangeln, wobei ihre
Körper die Algenfarbe annahm und auf der Haut algenähnliche
Auswüchse emporquollen. Ein anderes Tier legte flüchtend die Arme
parallel nebeneinander wie eine horizontale Heckflosse, während sich
sämtliche Armspitzen säuberlich einrollten. Gewöhnlich ziehen
schwimmend flüchtende Kraken die Arme nur wie ein Bündel Tauenden
hinterher. Den Vortrieb erzeugen sie nach dem Rückstoßprinzip durch
kräftiges Zusammenpressen der Mantelhöhle. Das so beschleunigte
Wasser entweicht über ein bewegliches Atemrohr, den so genannten
Trichter. Meist aber hangeln sich Kraken auf ihren Armen über den
Meeresgrund.
nach unten
nach oben
Seegurken
Doch
zurück nach Argentella. Ich finde den Tintenfisch nicht mehr und fotografiere dafür
Schwämme, Algen und Moostierchenkolonien. Nach einer knappen Stunde
lege ich eine Pause ein und bleibe gleich im Anzug. Schnell ein
Stück trocknes Brot gegessen. Film- und Objektivwechsel. Etwa
30 Minuten später buckele ich wieder das Tauchgerät.
Die Fauna
scheint mir fast schon vertraut: Seeigel, Grundeln, Schleimfische,
Wachsrosen. Und überall die runzligen 20 bis 30 Zentimeter langen
Seegurken. Manche schimmern schwarz; die meisten aber sind braun
oder durch am Körper haftende Partikel des Grundes grau und fleckig
wie Schimmel. Die Seegurken oder Seewalzen gehören zum Stamm der
Stachelhäuter. Ihre Artgenossen, die Seeigel, besitzen ein kalkiges
Außenskelett. Den Seegurken bleiben lediglich Kalkkörperchen auf der
weichen Haut. In manchen exotischen Abenteuerromanen ist von Trepang
die Rede. Trepang ist nichts anderes als der in Streifen
geschnittene und getrocknete Körper bestimmter Seegurken.
In den
Wasserlungen und Leibeshöhlen von Seegurken der Gattungen Holothuria
und Stichopus hausen manchmal Nadelfische. Die bis zu 20 Zentimeter
langen Tiere sind echte Parasiten und fressen die Innereien der
Seegurken. Wird die Duldsamkeit oder Regenerationsfähigkeit durch zu
viele Plagegeister überschritten, schleudert die Seegurke ihre
Eingeweide samt Nadelfischen heraus und beginnt, sich ein neues
Innenleben aufzubauen. Aufgeregt sausen die Nadelfische durch das
Wasser zu einer anderen Seegurke. Durch Abtasten und am
Atemwasserstrom finden sie die Afteröffnung heraus und schlüpfen in
ihr neues Wirtstier. Die Jungen der Nadelfische benötigen zu ihrer
Entwicklung die Geschlechtszellen der Seegurke als hochwertiges
Kraftfutter.
Die
Seegurken sind genügsamer. Sie kriechen schneckenlangsam über die
Gründe und schaufeln mit einem die Mundöffnung umsäumenden
Tentakelkranz organische Nahrungspartikelchen enthaltenen Sand und
Schlamm in sich hinein. Aber die scheinbare Bewegungslosigkeit
erleichtert das Fotografieren kaum - denn wie, bitte schön,
arrangiert man ein schönes Bild mit einem „schimmeligen Würstchen“?
Zuletzt
schwimme ich entlang dem für einen Nachteinstieg geplanten Kurs.
Landmarken und Unterwasserkompass sind die wichtigsten
Orientierungshilfen. Ich präge mir die ungefähre Topografie ein. Es
beruhigt, nachts auch nicht noch mit unbekannten Hindernissen,
Fischernetzen, Strömungen, plötzlichen Steilabfällen und anderen
gewöhnlich nur eingebildeten Gefahren rechnen zu müssen. Als ich mir
endlich den Tauchanzug vom Leib zerre, ist es später Nachmittag. Ich
war fast drei Stunden im Wasser. Mein Magen ist leer wie eine leere
Tüte.
nach unten
nach oben
Nachteinstieg
Ein
nächtlicher Einstieg
hat mindestens drei Vorteile: Der Taucher sieht eventuell tagsüber
verborgen lebende Arten, andere Tiere schlafen oder ruhen und sind
eher zu überraschen. Und schließlich verharren manche Fische wie
erstarrt im Scheinwerferlicht und lassen sich so leichter
fotografieren.
Um halb acht
Uhr bin ich erneut ausgerüstet und stiefele mit angenehmsten
Erwartungen in die See. Wenigstens nachts sollten doch einige
ungewöhnliche Schnappschüsse möglich sein. Der Schein meiner
wasserdichten Taschenlampe irrlichtert über den spärlich bewachsenen
Grund. Außer den obligatorischen Seeigeln und Seegurken ist weit und
breit kein Tier in Sicht. Ich schwimme in Richtung des südlichen
Felsufers der Bucht. Die ersten Steinblöcke recken ihre fahlen
Gesichter aus dem Dunkel. Der Zeiger des Tiefenmessers nähert sich
der 3-Meter-Marke.
Ich taste
mit dem Lichtkegel systematisch die voraus liegenden Regionen ab.
Zwei smaragdgrüne Punkte leuchten auf: die Augen einer großen
Grundel. Ich richte den Schein auf den am Fuße eines Steinblocks
liegenden Fisch. Grundeln besitzen zwei deutlich getrennte
Rückenflossen. Sie sind auch an der typisch keulenförmigen Gestalt
leicht zu erkennen, jedoch oft schwer genauer zu bestimmen. Im
Mittelmeer leben etwa 25 Arten. Viele Grundeln sind recht bequeme
Gesellen. Meist liegen sie träge am Grund herum. Nur wenn man ihnen
zu nahe rückt, raffen sich die Tiere zu einem blitzschnellen Satz
von allenfalls einem Meter Weite auf. Faultiere könnten von ihnen
noch lernen. Die größte Grundel des Mittelmeeres ist mit maximal
28 Zentimeter Länge die Große Meergrundel.
Eigentlich
müssten hier auch Schleimfische zu finden sein. Ich sah sie bei
Tageslicht oft genug. Im Flachwasser mediterraner Felsküsten -
ebenso im Schwarzen Meer und im mittleren Ostatlantik - gibt es
ohnehin nur wenige Areale, in denen sich die neugierigen Tiere nicht
tummeln. Alfred Brehm bezeichnete sie einst als „Gassenjungen des
Meeres“. Ich lasse den gelblichen Lampenschein über den Steinblock
wandern, dann über den nächsten. Liegen die Schleimfische in ihren
Verstecken und schlafen? Halt! Da war doch etwas. Tatsächlich: Aus
einem Spalt im Steinblock äugt - der besseren Übersicht halber auf
die Brustflossen gestützt - einer der possierlichen Schleimfische.
Ihr Name bezieht sich auf ein wichtiges Merkmal dieser Tierfamilie,
der Blenniidae: die den schuppenlosen Körper bedeckende dicke
Schleimschicht. Die Mittelmeerfauna umfasst etwa 20 überwiegend
finger- bis handlange Arten. Die meisten Schleimfische tragen auf
der Stirn ein Paar ausgefaserte Hautläppchen (Tentakel). Die
fehlende Schwimmblase erschwert ihnen den Aufenthalt im freien
Wasser. Schleimfische leben gewöhnlich in Schlupfwinkeln oder deren
Nähe - und seien es leere Büchsen oder Flaschen. Der „Blenni“ hier
ist aber zu klein für mein Objektiv, als dass sich eine Aufnahme
lohnte. Weiter also.
Fünf Meter
Tiefe. Ich schwenke fleißig die Lampe. Von Zeit zu Zeit beunruhigt
mich das Spiel der dem Licht hinterherhuschenden Schatten: unstete
Bewegungen, deren Konturlosigkeit wie immer genug Raum für eine
Vielzahl von Missdeutungen gewährt. Ein roter Fleck leuchtet auf wie
ein Stopplicht. Ich schwimme näher. Das strahlende Gebilde erweist
sich als eine Purpurseescheide, neben der Glaskeulenseescheide eine
der schönsten Ascidien im Mittelmeer. In der Anatomie der
Seescheiden (Ascidiacea) finden sich Anklänge an die Entwicklung der
Wirbeltiere. Ihre freischwimmenden Larven besitzen ein Neuralrohr
und eine Chorda. Die Chorda ist ein Stützstab, um den herum sich bei
höheren Wirbeltieren die Wirbelsäule ausbildete. Ihre Reste sind bei
den Wirbeltieren als Zwischenwirbelscheiben noch erkennbar. Während
der Umwandlung der Ascidienlarven zu den sesshaften Alttieren geht
die Chorda freilich wieder verloren.
Ehe ich
weiter in die nächtliche See hinausschwimme, lasse ich - in
unbequemster Verrenkung, um die Purpurseescheide recht ins Bild zu
setzen - den Blitz zweimal aufleuchten. Dann finde ich wieder über
weite Strecken kein Lebewesen. Dagegen erscheint ja die heimatliche
Ostsee wie ein Zoo! Endlich ein junger Lippfisch - ich knipse ihn
auf der Wiese eines mit Trichteralgen und Cystoseira (in den
obersten Wasserschichten häufige, lichtbedürftige Braunalgen)
bewachsenen Hanges.
nach unten
nach oben
Ich
schalte das Licht aus.
Über mir schimmert bleigrau und gebuckelt die Oberfläche, an der das
verzerrte Oval des Mondes schwimmt. Ringsum sehe ich etwa so viel
wie nachts im Tannenwald: Es ist nicht völlig dunkel, dennoch sind
kaum Details zu erkennen - aber man spürt fast physisch Konturen und
hört den „Atem“ der Bäume. Auch das Meer zischelt, wispert und
knackt geheimnisvoll. Misstrauisch versuche ich die Finsternis zu
durchdringen. Was an optischer Wahrnehmungsfähigkeit verlorengeht,
ersetzt rasch die Fantasie mit allerlei Chimären. Mein Kopf pendelt
wie ein Abtastradar. Fürchte ich aus dem Dunkel herangleitende
Untiere? Nonsens! Aber ist es das wirklich? Beklemmend wird mir
plötzlich bewusst, dass ich in einer menschenverlassenen Bucht ganz
allein am Grund des Mittelmeeres hocke. Bloß wieder Licht. Der
Schalter knackt. Ich lasse die Lampe kreisen - und brummele
überrascht in das Mundstück. Was ist das?
Der
Lichtstrahl erfasst ein stacheliges und überall mit kleinen Warzen
bedecktes Tier von enormen Ausmaßen. Ich traue meinen Augen kaum.
Ein grün-braun gefärbter Eisseestern von mindestens einem halben
Meter Durchmesser! Mit den Zwischenringen hinter dem Objektiv
erhalte ich jedoch nur einen Ausschnitt von dem größten der
europäischen Seesterne. Egal. Wer weiß, ob es noch etwas anderes zu
fotografieren gibt; und mit dem angefangenen Film möchte ich nicht
noch einmal ins Wasser. Ich belichte Bild um Bild, während das Tier
dem Lampenstrahl zu entkommen sucht.
Kurz nach 21
Uhr sitze ich wieder im Auto. Kamera und Tauchausrüstung sind
verstaut. Es herrscht eine Temperatur von etwa 15 Grad Celsius.
Angenehm, sich nicht gleich in eine Decke wickeln zu müssen. Die
milde Luft, sanft rauschendes Wasser und das stille Mondlicht
verleiten zum Sinnen. Ich schlürfe bedächtig meinen Schlummergrog
und denke an den letzten Tauchgang. In den 30 Minuten sah ich nur
sehr wenige Tiere. Eine Folge der Meeresverschmutzung?
nach unten
nach oben
Meeresverschmutzung
Immerhin
hat im letzten Jahrzehnt, ebenso wie Nordsee und
Ostsee, besonders das Mittelmeer als „Müllgrube Europas“ herhalten
müssen. Alle Anrainer versenken ausnahmslos feste und flüssige
Abfallstoffe ins Meer - eine besonders billige Form der Beseitigung.
Die Mengen differieren freilich je nach dem wirtschaftlichen und
technologischen Entwicklungsstand der Länder. Behauptet wurde, dass
Strömungen, Wellenschlag und Absinkvorgänge die Stoffe weiträumig
vermischen und dadurch auf unschädliche Konzentrationen verdünnen.
Dies erwies sich als Trugschluss.
Italien ist
die größte südeuropäische Industrienation. Es hat eine geschlossene
Küstenlinie von über 8000 Kilometer und in jedem Jahr mehr als 40
Millionen Urlauber. Es besitzt jedoch auch in absehbarer Zeit nicht
die finanziellen Mittel, diese Situation wesentlich zu ändern. Tag
für Tag ergießen sich also weiterhin die Fäkalien der meisten
italienischen Küstenstädte mit ihren Krankheitserregern ins Meer,
werden - entgegen den gesetzlichen Bestimmungen noch viel zu wenig -
Strände für den Bade- und Wassersportbetrieb gesperrt und es beginnt
durch die Überdüngung fast jedes Jahr im Herbst das Fischsterben in
der nördlichen Adria.
Heimtückischer noch wirken die Industrieabwässer mit ihren nicht
oder nur sehr langsam biologisch abbaubaren schädlichen
Bestandteilen wie Schwermetallsalzen von Quecksilber, Blei, Chrom,
Cadmium, Nickel und Arsen. Sie werden von den Meerestieren
aufgenommen und gelangen direkt oder über die Nahrungskette auf den
häuslichen Tisch. Schäden beim Menschen an den Nervenzellen, im
Gehirn und Knochenbau, im Magen-Darm-Trakt, in Leber und Nieren
sowie Krebs erregende Wirkungen und Erbschäden sind nachgewiesen.
Vor Alicante, Marseille, Athen, Ismir, Haifa und vor mehreren
italienischen Küstenstädten wurden in den letzten Jahren bereits
bedenklich hohe Metallkonzentrationen gemessen. Zu den Metallen
gesellen sich unter anderem jährlich etwa 50 000 bis 100 000 Tonnen
Erdöl durch Verluste bei Transport und Verarbeitung, dazu die sich
wie ein Leichentuch über alles Leben - und dieses erstickend - am
Meeresgrund ausbreitenden Rückstandsschlämme der
Aluminiumproduktion, die Insekten- und Unkrautvernichtungsmittel,
die mit den Flüssen und dem Grundwasser ins Meer geschwemmt werden,
sowie polychlorierte Kohlenwasserstoffe der Elektroindustrie.
Liegt das
Mittelmeer nun auch hier - weitab vom Festland und vor einer Insel
ohne nennenswerte Industrie - bereits im Sterben? Ich lege die
Zeitschrift mit den alarmierenden Angaben beiseite und lösche das
Wagenlicht.
nach unten
nach oben
Calvi
Als meine
Brot- und Druckluftvorräte
aufgebraucht sind, fahre ich nach Calvi, einer alten und mit ihren
Palmen und Treppengassen fast afrikanisch anmutenden ehemaligen
Festungsstadt Genuas. Es liegt bis zu 81 Meter über dem Meer auf
einer Landspitze des Balagne-Gebirges. Von welcher Seite man sich
auch Calvi nähert, stets beherrschen die wuchtigen Mauern der im 13.
Jahrhundert zur Festung ausgebauten Zitadelle das Bild der Stadt.
Sie erwarb sich im Lauf der Geschichte den Ruhm der
Uneinnehmbarkeit. Der britische Admiral Nelson ließ 1794 das derzeit
den Franzosen treue Calvi mit 4000 Kanonenkugeln zertrümmern. Nelson
verlor dabei sein linkes Auge, Hunderte von Menschen aber ihr Leben;
doch gesiegt hat er nicht, der Admiral.
Auf den
ersten Blick erscheint das rund 2500 Einwohner beherbergende Calvi
wie ein idyllisches Städtchen, zumal die Hauptwelle der Touristen
schon wieder heimgeflutet ist. Aber das schräge, streifige Licht der
Herbstsonne demaskiert unbarmherzig die Gassen, Durchgänge und
Treppen: Stockflecken, Moder, grindiger, bröckelnder Putz. Aber je
dichter man sich dem heutigen Zentrum Calvis nähert, dem Areal um
die Hafenpromenade der Unterstadt, desto mehr Farbtupfer übertünchen
die Tristesse: die bunten Auslagen der Geschäfte, die
Souvenirvitrinen und Boutiquen, Blickfänge von Gaststätten. Die
Läden haben bereits geöffnet. Einige Touristen, zu erkennen an ihren
Kameras und Kleidern, Kinder und schwarzgekleidete alte Leute
beherrschen das Straßenbild. Das wird sich auch am Abend kaum
ändern. Überall fehlen Arbeitsplätze. Etwa 95 000 gebürtige Korsen
leben deshalb auf dem Festland. Sie besuchen oft nur einmal im Jahr
die Insel, die heimatlichen Dörfer, um hier ihre Ferien zu
verbringen. Erst mit Erreichen des Rentenalters kehren die meisten
endgültig zurück und setzen sich aufs Altenteil. Deshalb besteht
heute fast die Hälfte der korsischen Bevölkerung aus Pensionären.
An der
Hafenpromenade entdecke ich Calvi-Bateaux, ein Wassersportgeschäft.
Ich frage nach Druckluft. Ja möglich: elf Franc (damals etwa 2,5 Euro)
für anderthalb Kubikmeter, also eine Flaschenfüllung. Damit ist der
Nachschub an Pressluft gesichert. Morgen also die nächsten
Tauchgänge mit dem Atemgerät.
Freilich
hatte ich die Rechnung ohne Petrus gemacht. Nachts tobt ein
schauerliches Unwetter. Wind rast heulend über die Insel. Regen
peitscht die Erde. Blitze zucken gespenstig. Der Wagen wankt unter
dem Ansturm der Elemente. Nach vielleicht einer Stunde lässt das
Toben nach. Ich versinke in einen unruhigen Schlaf. Einer der
letzten Gedanken: Tauchen ade! Hätte ich doch bloß den schönen Tag
wenigstens zum Schnorcheln genutzt! Befreundete Taucher kamen auf
Sardinien wegen der Stürme fast drei Wochen lang nichts ins Wasser.
nach unten
nach oben
Golfe de Porto
Am
nächsten Morgen
schwarzer Himmel, Wind und hohe Wellen. Mindestens 200 Meter landein
gefegte Gischt. Ich lenke das Auto weiter nach oben und frühstücke.
Immer noch sprüht Seewasser an die Fenster. Gegen elf Uhr verlasse
ich das Camp und fahre über die Küstenstraße nach Galéria, einem
Fischerhafen am Golfe de Galéria. Ein stilles abgelegenes Dörfchen.
Pensionen, Hotels und Zeltplätze verraten, dass zumindest in der
Saison mehr die Badegäste die Einkünfte sichern als der Fischfang.
Die Küstenstraße endet nach dem Passieren des Ortes direkt am
südlichen Ende des Golfes. Man könnte hier mit der Taucherausrüstung
bequem über eine kleine Treppe ins Wasser steigen. Aber die See ist
viel zu rau. Also weiter in Richtung Porto. Kaum Verkehr. Manchmal
führt die schmale Straße kilometerweit landein, dann über eine
Brücke wie aus Napoleons Zeiten und zurück zum Meer. Terraingewinn
entlang der Küste nur wenige hundert Meter; aber dazwischen lag eben
ein Tal oder eine weit ins Land reichende Bucht. Etwa anderthalb
Kilometer östlich des Aussichtspunktes Bocca â Croce ein Schild nach
rechts: La mer. Also ans Meer. Durch das kleine Dorf Osani geht es
über eine abenteuerlich schmale und steile Straße hinab direkt an
den Strand am Golf de Porto. Hohe Felsen rahmen die Bucht. Im
Hinterland ist Platz für einige Zelte und Caravans. Ein Bach mit
Süßwasser zum Spülen der Tauchgeräte. Eine schiefe, rohgezimmerte „Snackbar
Chez Doumeé“, natürlich geschlossen. Ein herrlicher Platz zum wilden
Kampieren und sicher auch zum Tauchen. Aber Tauchen ist bei der
aufgewühlten See unmöglich. Ich fahre auf einen windgeschützten
Stellplatz für die Nacht.
Kälte ist
immer noch der beste Wecker. Ein Temperaturabfall auf wenige Grade
über Null jagt mich am Morgen beizeiten aus dem Schlaf. Ich laufe
hinab ans Wasser. Meterhohe Dünungswellen schlagen an die Klippen
und machen das Tauchen zu einem gefährlichen Abenteuer. So
beschließe ich endgültig eine Korsikarundfahrt zu unternehmen: quer
über die Insel bis an die Ostküste, dann nach Süden und zurück
entlang der Westküste wieder bis hierher in diese Bucht.
Bei Porto
verlasse ich das Meer und folge dem Verlauf der Straße in die Berge.
Der Wind legt sich. Der Himmel wird zusehends lichter. Die Sonne
scheint. Vor Ota, an einsamer Landstraße, stehen am Berghang viele
Familiengrüfte. Manche sind prächtig gebaut, mit exotischen Bäumen
umstanden und erinnern an Mausoleen. Andere, die Mehrzahl, sind
bescheidener, mit passabler Fassade, aber dahinter nur ein kleiner
Anbau. Für die Korsen war der Besitz einer Familiengrabststätte von
großer Bedeutung. Die Ursache liegt in der korsischen Geschichte
begründet: Das Leben der Inselbewohner war in all den wirren
Zeitläufen oft freudlos, voller Mühsal, Sorgen und Gefahren. Der Tod
das einzig sichere.
nach unten
nach oben
Ota bis Solenzara
Ota ist ein
Bergdorf
mit etwa 40 überwiegend zwei- bis dreistöckigen Häusern, wie häufig
auf Korsika. Diese Bauweise erlaubt, mehrere Generationen unter
einem Dach zu vereinen, spart bei gleicher Wohnfläche Platz und
Baumaterial und gleicht besser die täglichen Temperaturschwankungen
aus. Von weitem sieht Ota aus, als seien Spielzeughäuschen an die
Südwand eines gewaltige Bergkessels geklebt, der Gorges de Spelunca.
Bis zu 1000 Meter hohe Felswände säumen das Tal, an dessen Grund das
Flüsschen Porto hinabjagt zu dem gleichnamigen Golf. Der Blick in
den mehrere Kilometer breiten Kessel ist großartig, beeindruckend,
wie die meisten Landschaften auf Korsika. Doch wie das
Zusammenwirken von Baumgruppen, Gebüsch, Macchia und nacktem Fels
schildern? Wie den unsteten Wolkenzug, das wechselnde Lichterspiel
auf den Hängen, das Gefühl von Einsamkeit angesichts dieser Weite
und Kargheit oder wie gar den Duft - als habe ein Gewürzkrämer
sämtliche Schubladen geöffnet - beschreiben? Wie all das
fotografieren?
Kurz vor dem
Pass Col de Vergio ein gefährlicher Zwischenfall: Ein mir
entgegenkommendes Auto gerät ins Schleudern und überschlägt sich.
Glücklicherweise kommt niemand zu Schaden, weder der Fahrer noch
sein Hund. Wir schieben das schrottreife Vehikel an den Straßenrand.
Die nächsten Kilometer fahre ich sehr behutsam . . .
Col de
Vergio, Aussichtspunkt in 1484 Meter Höhe. Schneidender Wind. Vor
einer Stunde noch schwitzend im T-Shirt, wate ich nun durch
knöcheltiefen Schnee. Aber das Panorama entschädigt, wie schon viele
Male, für alle Strapazen. Ich schaue vom Pass weit hinab ins Land.
Von hier aus erstreckt sich nach Nordosten die Niolo, eine raue Alm-
und Waldlandschaft mit alpinem Klima, nur von sechs Dörfern
besiedelt. Die nordwestliche Seite der Niolo beherrschen die immer
schneebedeckten Zwei- und Zweieinhalbtausender der
Monte-Cinto-Gruppe. Der Monte Cinto selbst ist mit - je nach Karte -
2706 oder 2710 Meter die höchste Erhebung Korsikas. Aber welcher der
weißen Gipfel ist das?
Nach einigen
Kurven führt die Straße fast gerade und mit mäßigem Gefälle bergab.
Ich lasse den Trabant rollen. Die Laricokiefern bleiben zurück, die
Macchia, die Kastanienwälder. Hinter Calacuccia ein den Golo
zügelnder Staudamm. Die Felswände rücken immer enger zusammen. Das
Asphaltband krümmt sich zu Mäandern. Ich durchquere die
„Höllenschlucht“ Scala di Santa Regina, eine der
Touristenattraktionen auf Korsika. Sie erschreckt durch ihre
Trostlosigkeit. Bis zu 500 Meter aufragende nackte Felswände, die
sich dicht gegenüberstehen und zwischen denen der Golo - er schuf
diese Schlucht - in schäumenden Wirbeln und Kaskaden nach Nordosten
hinab zur Küste stürmt. Ein Grand Cañon en miniature.
Kurz vor
Francardo erlauben die Straßenverhältnisse erstmals wieder eine
„höllische Raserei“. Ich fahre mit 50 Kilometer/h! Bei Casamozza,
fast an der Ostküste, gabelt sich die Chaussee. Ich fahre in
Richtung Süden. Die Berge bleiben zurück. Das Land wird flach und -
nach den Eindrücken aus den Felslabyrinthen - sanft, brav. Die nun
gut ausgebaute Straße führt entlang der Küste. Ortschaft reiht sich
an Ortschaft. Traubengefüllte Kipper tuckern zu den zahlreichen
Kelter- und Destillierfabriken. Es ist die Zeit der Spätlese.
Saftige rote Trauben! Mein Organismus reagiert wie bei Pawlow der
Hund. Zwei ziemlich abgerissene Typen, die mit zufriedenen Mienen
aus einem Weinfeld kommen, geben den Ausschlag. Eine halbe Stunde
später biege ich wieder auf die Hauptstraße.
In der
Gegend um Solenzara ragen erneut Berge empor. Die Straße schlängelt
sich um die Felsen, die bis an die Küste herantreten. Porto-Veccio.
Der Ort ist berühmt durch seine Korkeichen und den Handel mit
bearbeitetem Kork. Die Bäume dürfen nur alle zehn Jahre geschält
werden. Danach, ohne Rinde, machen sie einen traurigen Eindruck.
Porto-Vecchio besitzt unter anderem eine Zitadelle aus dem 16.
Jahrhundert, feinsandige Strände und rund 7000 Einwohner. Als ich in
den Ort fahre, sind scheinbar alle 7000 unterwegs. Ich kämpfe mich
durch dichtesten Verkehr rasch wieder hinaus. Kurz vor Bonifacio
findet sich ein verstecktes Übernachtungsplätzchen.
nach unten
nach oben
Wirtschaft,
Familie und Politik
Es liegt
nicht nur
an der merklichen Abendkühle, dass sich der Schlaf schwer einstellt.
All die herrlichen wilden Landschaftsbilder wirbeln durch meine
Sinne. Nun glaube ich, einige Probleme Korsikas besser zu verstehen:
wenig land- und forstwirtschaftliche nutzbare Flächen, eine
ungenügende Energieproduktion und so gut wie keine Industrie. Die
Insellage verteuert alle Ein- und Ausfuhren. Die Höfe korsischer
Bauern liefern ihren Besitzern kaum das Existenzminimum. Schwerpunkt
der Landwirtschaft ist immer noch die Viehzucht, eine reine
Weidewirtschaft mit Schafen und Ziegen. Die Tiere streifen oft frei
umher, richten umfangreiche Forst- und Weideschäden an; deshalb ist
nur eine mäßige Nutzung der ohnehin spärlich vorhandenen Flächen
möglich.
Den jüngeren
Leuten sagt das unkomfortabele, bescheidene Dasein meist nicht zu.
Sie verlassen die Dörfer, die Insel gar, um anderswo ihr Auskommen
zu suchen. Dutzende von Landschulen wurden geschlossen. Dabei wäre
es gerade die Jugend, die am ehesten die halbfeudalen
Produktionsverhältnisse modernisieren könnte. Aber das Landesinnere
entvölkert sich immer mehr. Überall sah ich aufgegebene Häuser,
Höfe, Güter . . .
Zuwanderungen, wie etwa die der 10 000 „Pieds noirs“ (Schwarze
Füße), ehemalige Siedler aus Algerien, veränderten kaum die
Situation. Die Korsen beobachteten misstrauisch diese mit
erheblichen Subventionen geförderte Ansiedlung. 1975 gab es die
ersten blutigen Zusammenstöße. Die eindeutig rassistisch geprägte
und vielleicht auch von rechtsradikalen Kräften unterwanderte „Front
zur Befreiung Korsikas“ (FLNC) der Separatisten sprach vom
Völkermord durch Verdrängung. Ihre Hauptparole: „Franzosen raus aus
Korsika!“ Die FLNC half gerne etwas mit Bomben nach. Sie wurde Ende
1982 nach Attentaten in Ajaccio verboten. Andererseits ist
beispielsweise für den intensiven Weinbau und die Winterbearbeitung
der Getreide- und Frühgemüsekulturen - erste Anzeichen des
einsetzenden landwirtschaftlichen Strukturwandels - alljährlich die
Hilfe mehrerer tausend Italiener notwendig.
Das ferne
regierende Paris nahm bisher kaum Rücksicht auf die nationalen
Besonderheiten Korsikas. Doch die Korsen sind ein Volk mit eigener
Geschichte, eigenem Brauchtum und eigener Sprache, einem
toskanischen Dialekt. Da der jeweils herrschende Staat fast nie ein
korsischer war, misstrauten die Korsen stets dessen Gesetzen. Sie
unterstützten den Staat nicht, sondern lebten nach eigenem
Stammesrecht. Die Abgeschlossenheit und Unzugänglichkeit der Insel
begünstigte das Weiterbestehen patriarchalischer Sippen und Clans
bis in die Gegenwart.
Einer der
typischsten mentalen Züge der Korsen ist die Bindung an die Familie.
Nur durch den Zusammenhalt in Großfamilien und Clans vermochten die
Korsen als Volk all die wirren Zeitläufe zu überleben. Der Clan ist
die Gruppe von Familien eines Dorfes oder eines Tales oder
irgendeiner anderen geographisch geschlossenen Einheit. Was der
Älteste, der Patriarch einer Sippe oder der Chef eines Clans,
anordnet, ist Gesetz. Frauen haben generell nichts zu sagen, junge
Leute sich unterzuordnen. Durch die Clans entstand in den Gemeinden
praktisch ein Parallelsystem zur staatlichen französischen
Verwaltung.
Noch heute
geht fast nichts ohne Zustimmung der Clans. Dass die durchweg
konservativen Herren aber nicht für demokratische Reformen,
landwirtschaftliche Genossenschaften oder gar sozialistische Ideen
eintreten, wundert nicht. Doch 1977 gelang es bei Gemeindewahlen
jungen fortschrittlichen Kräften erstmals, die Vorherrschaft eines
lokalen Clans zu brechen; eine Ausnahme zwar, aber auch ein neuer
Anfang. Der Wahlsieg eines sozialistischen Staatspräsidenten im Mai
1981 bedeutete eine weitere Hoffnung für Korsika. Im Rahmen des für
ganz Frankreich vorgesehen Dezentralisierungsprogramms Mitterands
erhielt Korsika 1982 als erstes Departement ein Autonomiestatut und
eine Nationalversammlung mit 61 Volksvertretern, ohne freilich ganz
in die Unabhängigkeit entlassen zu werden. Aber das forderte nicht
einmal die UPC, die Union des korsischen Volkes und älteste
Organisation der Autonomisten. Außenpolitik, Verteidigung und
Währungsangelegenheiten sollen die Sache Frankreichs bleiben.
Noch vor
Jahren hieß es in Anspielung auf den Flugtourismus: „Korsikas
Rettung kommt aus der Luft!“ Jedes Jahr kommen weit über eine
Million Menschen. Die konservative Regierung Frankreichs hatte lange
zur wirtschaftlichen Verbesserung Korsikas vor allem auf die Karte
Tourismus gesetzt. In den siebziger Jahren arbeiteten zeitweilig ein
Drittel aller berufstätigen Korsen im Dienstleistungsgewerbe; Anfang
der achtziger Jahre bereits jeder zweite. Aber die
Tourismusförderung ist keine befriedigende Lösung: Die
Beschäftigungslage ist saisonabhängig. Es werden nur die Küsten
erschlossen. Von dem auf Korsika ausgegebenen Geld bleibt zu wenig
auf der Insel. Welche Zukunft gibt es also für Korsika? Es ist noch
immer alles offen . . .
Als die
Nacht endet trage ich unter dem viel zu dünnen Schlafsack drei
Hosen, Pullover und Anorak. Das Thermometer steht auf zwei Grad
Celsius. Auch auf Korsika bedeutet ein sternenklarer Himmel ebenso
schöne warme Tage wie kalte Nächte.
nach unten
nach oben
Bonifacio
In
Bonifacio
parke ich direkt am Hafenbecken unterhalb der Festung. Parkplätze
sind jetzt kein Problem. In der Saison wäre hier alles mit Autos
vollgestellt.
Bonifacio:
„Eine der malerischsten und originellsten Städte Europas, vom
Volksmund schwarze Perle' genannt“, schwärmt mein
Grieben-Reiseführer. „Die alte Feste liegt dreiseitig meerumgeben
und von Sardinien durch eine 12 Kilometer breite Meerenge getrennt,
auf einem 64 Meter hohen und 1500 Meter langen uneinnehmbaren
Kalksteinfelsen, der gleichzeitig den buchtartigen Naturhafen
schützt. Die Bonifacios sind fleißige Seeleute, Fischer und Bauern.
Doch das Leben hier ist hart, die Erträge bleiben karg, so dass die
Bevölkerung immer noch abnimmt. Die Genuesenstadt auf dem Felsen
blieb für die Korsen lange Zeit ein Fremdkörper ... Zwei berühmte
Männer hat Bonifacio beherbergt. Als Kaiser Karl V. 1550 von einem
Feldzug aus Nordafrika heimsegelte, zwang ihn ein Sturm, im Hafen
von Bonifacio Schutz zu suchen; das Haus, in dem er abstieg, wird
heute noch gezeigt. Napoleon Bonaparte befehligte 1793 als junger
Offizier einige Monate lang die Besatzung der Festung und wohnte in
der Zitadelle.“ Den Militärs haben die strategisch günstige Lage der
Festung und ihre dicken Mauern derart gefallen, dass sie immer noch
die historischen Stätte der Kriegsgeschichte besetzt halten. Jetzt
hat dort die Fremdenlegion ihren Standort.
Romantisches
Bonifacio? Ich weiß nicht. Verträumte Winkel sind nur ein Teil der
Realität. Weitaus stärker noch als in den Nebenstraßen Calvis
überwiegen in Bonifacio Verfall, Schimmel, modernde Bausubstanz.
Hier und da aufgegebene Wohnungen, verbarrikadierte Portale.
Ausdünstungen von Fäulnis, Spülwasser und Urin nisten in den engen
Gassen. Manche Häuser scheinen stützend aneinanderzulehnen,
Assoziationen an ein Kartenhaus erweckend. Zöge man ein Blatt
hervor . . . Romantisch mag die Altstadt nur dem flüchtig schauenden
Touristen erscheinen. Und doch beeindruckt vor allem die einmalige
Lage: hoch oben auf weißem Gestein, schwebend zwischen der Bläue von
Wasser und Himmel.
Bonifacio
ist das südlichste Städtchen Korsikas. Doch die südlichste
Grenzmarke der Insel - und damit ganz Frankreichs - ist nicht sein
Südkap Pertusato, sind nicht die Iles Cavallo, nicht die drei bis
vier Kilometer südöstlich Korsikas liegenden Iles Lavezzi. Es ist
eine Untiefentonne in der Straße von Bonifacio mit der Aufschrift „Lavezzi
Sued“.
nach unten
nach oben
Lavezzi
Etwa
anderthalb Jahre
nach jenem Rundgang durch Bonifacio passiert ein Konvoi von vier
Motorschlauchbooten - aus Richtung Sardinien kommend - jenes
gelbschwarze Seezeichen. Die Boote sind mit Tauchgeräten, Kameras
und Sporttauchern aus drei Staaten beladen. Ich habe das Glück, auf
Einladung einer meeresbiologischen Forschungsgruppe als
Unterwasserfotograf mit an Bord einer der Fahrzeuge zu sitzen. So
kann ich auch Lavezzi besichtigen und ganz im Süden Korsikas
tauchen.
Die Führung
hat das englische Schlauchboot mit Jeanne und Keith Nicholsen
übernommen; beide hochdekorierte „Diving Officers“ im British
Sub-Aqua Club, der größten westeuropäischen Sporttauchervereinigung.
Die Nicholsens betrieben einige Jahre eine kommerzielle Tauchbasis
auf Sardinien. Sie kennen daher See und Tauchgründe wie unsereins
die heimischen Gewässer.
Die Iles
Cavallo und Lavezzi sind die größten Inseln des unbewohnte kleinen
korsischen Archipels. Lavezzi hat eine Ausdehnung von etwa
1,5 Kilometer. Fjordartige Buchten zerklüften die aus hellgrauem
Granit bestehenden Eilande. Ihre Ränder säumen zahllose Riffe und
Felsnadeln. Wehe dem Schiff, das da bei Sturm hineingerät! Auf dem
wie ein Flugzeugträger aus dem Meer ragenden Felsen namens Accianno
steht eine 13 Meter hohe Gedenkstele. Das steinerne Mahnmal und zwei
Friedhöfe auf Lavezzi erinnern an das tragischste Schiffsunglück in
diesem Gebiet: den Untergang der Sémillante. Im Februar 1855
zerschellte die französische Fregatte während eines
Jahrhundertorkans an den Klippen von Accianno. Die gesamte Besatzung
- es waren 695 Mann - kam ums Leben. Viele Tage lang wurden
verstümmelte Tote an die Strände gespült, wehte der bittere Geruch
verwesender Leichen über die Insel. 560 Seeleute fanden auf Lavezzi
ihre letzte Ruhestätte. Auf dem Meeresgrund liegen heute noch
Überreste der Sémillante.
Wir landen
nur, um auf festem Boden in die Tauchausrüstung zu schlüpfen. Dann
brummen die Boote wieder hinaus auf die See zur Secca Lavezzi, der
Untiefe nördlich des gelbschwarzen Seezeichens. Keith findet nach
einigem Suchen einen geeigneten Ankerplatz, einen bis zwölf Meter
unter die Oberfläche aufragenden Felsen. Ansonsten fällt hier die
See ab bis auf Tiefen von 40 Meter. Die Straße von Bonifacio ist
nicht nur wegen der Windeinbrüche berühmt und berüchtigt, sondern
auch wegen der Strömungen. Aber wir haben Glück: Heute ist lediglich
eine geringe Wasserbewegung zu erkennen. Die letzten Handgriffe vor
dem Einstieg erfolgen unter den wachsamen „Fernrohraugen“ der
Kontrollbootbesatzung irgendeiner französischen Behörde. Die
Unterwasserlandschaften vor Lavezzi wurden vor etlichen Jahren zu
Naturschutzzonen erklärt. Jede bewusste schädigende Aktion, wie das
Harpunieren oder Sammeln mariner Organismen, ist hier bei Strafe
verboten. Wir hoffen auf eine vielfältige Meeresfauna und stürzen
erwartungsvoll ins Wasser.
Die Sicht
ist fantastisch.
Tief unten im blauen Dämmer die rundliche Felskuppe, von Spalten
zerfurcht, mit jähen Abstürzen. Hunderte von Mönchsfischen flitzen
gleich Schwalben um den Gipfel. Ich klinke meine außenbords hängende
Unterwasserkamera ab und schwimme am Ankerseil entlang in die Tiefe,
um den Ankersitz zu kontrollieren. Hier ist auch der Treffpunkt
unserer Gruppe.
Der erste
Eindruck: Alles scheint eine Nummer größer als gewöhnlich zu sein,
der Bewuchs auf den Steinen, die Schwämme und Schnecken, die
Blumentiere und Fische. Wir sind erst wenige Minuten unterwegs, als
mir Eveline ein Algenbüschel mit Beinen zeigt: eine Krabbe. Ich
hätte das Tier glatt übersehen. Krabben sind zehnfüßige Krebse mit
verkürztem abgeplattetem Körper. Im Gegensatz zu den
Langschwanz-Panzerkrebsen - wie etwa Langusten und Hummer - ist ihr
Hinterleib zurückgebildet, ohne Schwanzfächer und stets bauchwärts
eingeschlagen. Das von uns bestaunte Exemplar könnte eine Kleine
Seespinne sei. Ihr Rückenpanzer und die Beine besitzen viele
Hakenborsten. Auf ihnen befestigt sie - wie manch andere Krabbenart
- Algen und kleine Polypen. So wächst ein wandelndes Algenbüschel
heran. Die Tarnung ist fast perfekt. Auch später auf den Fotos ist
von der Krabbe nur die unbepflanzte Bauchseite erkennbar, die das
Tier etwas anhob, als es gegen meine sich nähernde Unterwasserkamera
in Verteidigungsstellung ging.
Eveline,
Markus und ich schweben an kleinen Felsterrassen entlang immer
weiter in die Tiefe. In der Ferne perlen hinter Steinblöcken
silbrige Blasenwolken von anderen Sporttauchern auf. Zwischen einem
Felseinschnitt scheint plötzlich durch einen wundersamen Zufall ein
Edelsteinregen zu fallen: ein Schwarm nur wenige Zentimeter großer
junger Mönchsfische. Ihre Körper strahlen in einem unwahrscheinlich
leuchtenden Kobaldblau. Erst mit der Reife erlischt dieses Blau und
verwandelt sich in eine bräunliche bis blauschwarze Tönung.
nach unten
nach oben
Gorgonien
Tiefe 15
Meter. Die ersten Gorgonien - Gestreckte Gorgonien - ragen wie
herbstkahle Sträucher aus dem Boden. Wir gleiten in das Reich der
Horn- oder Rindenkorallen, so heißen diese markanten Kolonien von
Blumentieren. Das für jene Ordnung typische Achsenskelett im
Stockinneren besteht aus biegsamen hornartigen Fasern mit
Kalkeinlagerungen; es umhüllt eine mit Kalkteilchen durchsetzte
weiche Rinde. Darin sind die Korallenpolypen eingebettet, daher auch
die Bezeichnung Rindenkorallen. Taucher aber bevorzugen die
verhaltene Poesie, die in dem lateinischen Namen mitschwingt:
Gorgonien.
Tiefe 18
Meter. Die Büsche und Fächer werden häufiger. Konturen und Färbungen
wechseln. Weiter oben wuchsen vor allem die wenig verzweigten
Gestreckten Gorgonien mit ihren fast parallelen Ästen. Sie leben
überwiegend an lichten Stellen und meiden Höhlen. Die nun
vorherrschenden Gelben Gorgonien bevorzugen dagegen Schatten. Auf
freien Felswänden sind sie erst in Tiefen über 15 Meter anzutreffen.
Ihre Fächer stehen wie Siebe quer zur Richtung der häufigsten
Wasserbewegung. So können die Polypen einen größeren Anteil aus dem
mit der Strömung vorbeitreibenden Plankton abfischen. Immer mehr
werden die gelblichen Formen von Roten Gorgonien abgelöst.
Tiefe 21
Meter. Wir erreichen unsere tiefste Stelle. Der Grund senkt sich
kaum noch. Hier und da schimmern an den Felswänden der
schluchtartigen Gänge und Spalten neben den großen Fächern Roter
Gorgonien kleinere fast blauschwarze Hornkorallen. Ich schalte die
Pilotleuchte ein. Das Blauschwarz verwandelt sich in ein herrliches
Violett, nach dem diese Tierkolonie auch benannt ist: Violette
Gorgonie, Paramuricea chamaeleon; der zweite Teil des lateinischen
Namens verrät eine Eigenart dieser Korallen: ihre Farbvariationen.
Sie können auch karminrot, an den Enden gelblich oder ganz gelb
gefärbt sein. Mir fällt ein, dass wir quer durch das Spektrum
häufigster Gorgonien des Mittelmeeres schwimmen.
Nur die
bekannteste Mittelmeerkoralle, die Edelkoralle, sehen wir nicht. Mir
glücken erst vor der spanischen Mittelmeerinsel Ibiza Aufnahmen von
Edelkorallen und zwar in Tiefen jenseits 40 Meter. Die Edelkoralle
muss aber auch im Seegebiet zwischen Sardinien und Korsika
vorkommen, denn in Nordsardinien ist eines der Zentren der
Korallenfischerei beheimatet. In Santa Teresa di Gallura sah ich
eine ganze Flotte jener Boote, die mit feinen Spezialnetzen die
roten Korallen von den Gründen losreißen - und dabei freilich viele
andere Lebewesen mit vernichten. In Santa Teresa leben außerdem
Korallentaucher. Etwa 20 Taucher fahren zwischen April und Oktober -
wenn immer es das Wetter zulässt - hinaus in die Straße von
Bonifacio. Sie müssen freilich zu Tiefen von 60 bis 110 Meter
hinuntertauchen, um mit wenigstens drei Kilogramm Korallenmasse noch
lohnende Mengen abschlagen zu können.
Aber die
Tage der Korallenernte hier sind gezählt: Zum einen werden durch die
Meeresverschmutzung die empfindlichen Korallenpolypen immer
seltener, zum anderen gewinnen die Umweltschützer in der sardischen
Regierung zunehmend Stimmen gegen die räuberische Tätigkeit der
Korallentaucher. Vor Lavezzi darf natürlich keiner ernten. Hier
können deshalb in größeren als den von uns aufgesuchten Tiefen noch
umfangreiche Bestände sein. Im Gegensatz zu den biegsamen Gorgonien
sind bei den Edelkorallen rötliche Kalkkörperchen (Spiculae) zu
einer kompakten Kalkmasse verklebt, die als Skelett fungiert. Sie
ist nach dem Entfernen des Weichkörpers das Rohmaterial für die
begehrten Schmuckwaren.
nach unten
nach oben
Zackenbarsche
Immer
wieder visiere ich
durch den Sucher der Kamera. Die Fülle der Objekte ist
überwältigend. Plötzlich kommt Jerry angehastet und winkt aufgeregt.
Wir folgen gehorsam und haben nicht die geringste Ahnung. Auf halber
Strecke wartet Keith. Er steht ein wenig abseits auf einer kleinen
Felskuppe und betrachtet uns wohlgefällig, etwa wie ein General auf
einer Tribüne den Vorbeimarsch seiner Elitetruppen. Wir passieren in
Gänseformation. Jerry dirigiert uns zu einer horizontalen
Felsspalte. Gespannt spähen wir in den kaum halbmeterhohen Schlitz -
und würden uns die Augen reiben, trügen wir nicht Tauchermasken. Da
sind - das ist doch nicht möglich - Zackenbarsche!
Vor über 40
Jahren, als in Frankreich an der Côte d'Azur das Tauchen als neue
Sportart entdeckt wurde, als der Schriftsteller Guy Gilpatric als
einer der ersten in Europa Fische freischwimmend mit dem Speer
jagte, als Hans Hass sich für das Tauchen zu interessieren begann,
als Jacques Cousteau und Frederic Dumas das erste wirklich
brauchbare Presslufttauchgerät erprobten - und vielleicht auch noch
10 bis 20 Jahre später -, waren die großen Zackenbarsche an
europäischen Mittelmeerküste nichts Ungewöhnliches. Aber immer mehr
Taucher fielen mit immer stärkeren Schussharpunen über die mächtigen
und leider auch sehr delikaten Tiere her. Die Barsche lernten rasch,
wie der flossentragende Mensch einzuordnen sei: als feindlich, als
lebensgefährlich. Sie zogen sich in größere Tiefen zurück. Die Jäger
folgten bald mit modernen Tauchgeräten. Die Zackenbarsche wurden
immer scheuer, mieden nach Möglichkeit überhaupt die Küstenregionen.
Große Tiere sind heute nur noch vereinzelt in wenig zugänglichen
Seegebieten und nur aus größerer Entfernung zu sehen.
Der
Wrackbarsch ist ein Eremit und bevorzugt ohnehin die Einsamkeit -
tiefes Wasser, die offene See. Manchmal folgt er Treibgut, um darauf
siedelnde Tiere zu fressen. Der kleinere Braune Zackenbarsch sucht
gern Höhlen und Spalten auf, auch Seegraswiesen am Fuß von Klippen
in über 10 Meter Tiefe. Er wird bis 1,4 Meter lang und ist ein sehr
geschätzter Speisefisch, zum Leidwesen der Unterwasserjäger und
Angler auch misstrauisch, schlau und deshalb schwer zu fangen. Aus
dem marinen Nahrungsangebot - Fische und Tintenfische - verdrückt
der Braune Zackenbarsch täglich eine Menge, die einem Drittel seiner
Körpermasse entspricht.
Während all
meiner Tauchgänge vor Korsika und Sardinien sah ich nur einmal große
Barsche (die kleinen Barsche wie Schriftbarsche, Sägebarsche und
Rote Fahnenbarsche nicht gerechnet). Und jetzt, in dieser Spalte,
nicht nur einer, sondern gleich fünf oder sechs Braune
Zackenbarsche. Rechnet man die durch Lichtbrechung an der
Tauchmaskenscheibe bewirkte optische Vergrößerung von einem Drittel
ab, messen die Tiere immer noch 50 bis 60 Zentimeter. Aufgeregt
hasten sie durch die steinernen Gänge. Kaum ruhiger bedienen wir die
Kameras. Markus' Scheinwerfer erhellt den Spalt, während ich drei
Blitze hineinschicke in der Hoffnung auf ein brauchbares Bild. Reine
Jagdgier . . . Dann wird es Zeit, umzukehren. Unser Luftvorrat ist
bis auf die Reserve verbraucht.
Doch zurück
nach Bonifacio. Ich verlasse das alte Städtchen. Zehn Kilometer
nordwestlich am Golfe de Ventilegne, wird das Land noch einmal
überraschend flach. Ich entdecke für das mittägliche Picknick eine
schöne seichte Bucht mit kiesigem Strand und dem Müll der letzten
Saison: Plastikflasche, Konservenbüchsen, Papier. Dann geht die
Fahrt weiter auf der Nationalstraße N 196 in die Montagne de Campa,
eine sanft geschwungene Berglandschaft. Zwei Kilometer vor der
nächsten Tankstelle geht mir der Kraftstoff aus. Ich pantsche mit
Zweitaktöl und Kochbenzin und schwöre - zum wievielten Male
eigentlich? -, ab sofort immer rechtzeitig zu tanken.
nach unten
nach oben
Ajaccio
Um die in der Heimat üblichen Kaffeezeit erreiche ich Ajaccio, die
Hauptstadt Korsikas. Bastia hat einige hundert Einwohner mehr als
Ajaccio, mehr Fabriken, den wichtigsten Hafen der Insel. Bastia
müsste eigentlich immer noch die Hauptstadt Korsikas sein. Bastia
hat aber einen historischen Nachteil: Als der etwas leichtsinnige,
zweiundzwanzigjährige Carlo Bonaparte wieder einmal die hübsche und
um vier Jahre jüngere Patriziertochter Letizia Romolino umarmte und
die Umarmung nicht ohne Folgen blieb, kam am 15. August 1769
Napoleon nicht in Bastia, sondern in Ajaccio zur Welt. Und er,
später mächtig geworden und immer noch auch Lokalpatriot, erklärte
auf Bitten seiner Mutter Letizia 1811 Ajaccio zur Hauptstadt.
Ajaccio strotzt natürlich von Gedenkstätten, Standbildern und Büsten
Napoleons. Mir ist aber der Kaiser und seine Hinterlassenschaft
momentan völlig egal. Ich sah heute schon zu viel. So schlendere ich
nun ziellos durch Ajaccio. Der Feierabendverkehr tobt durch die
Hauptstraßen. Müdigkeit, Staub, Autoabgase verdrängen gründlichst
alle Einflüsterungen, auf den Spuren Napoleons wandeln zu wollen.
Ich bin froh, als ich wieder im Wagen sitze und weiter nach Norden
holpere, in Richtung jener stillen Bucht am Golf von Porto. Es
beginnt zu dunkeln.
Die Calanche
ist eine wenige Kilometer südlich Portos am Golf gelegene
Felslandschaft mit bis zu 500 Meter aufragenden Felsnadeln. Sie
bestehen aus gelbrotem Granit. Ähnlich wie beim weniger schroffen
Pendant in Bulgarien, den bis 150 Meter hohen Felsen von
Belogradtschik, entstanden durch Erosionen im Laufe von
Jahrtausenden wunderlich geformte Steingebilde. Manche erhielten
hier wie dort wegen vager Ähnlichkeiten in den Konturen Namen:
beispielsweise Elefant, Hundekopf und Riese hier; Reiter, Mönch und
Bär dort.
Als ich an
einem der letzten möglichen Aussichtspunkte halte und in die
Calanche schaue, scheint bereits der Mond. Sein bleiches Licht
schimmert auf dunklen, bizarren Steingebilden und Felsnadeln. Die
Aussicht ist großartig und ein wenig gespenstig. Huschten da nicht
riesige Fledermäuse um die Zinnen?
In der
Dunkelheit ist es schwer, einen gemütlichen Übernachtungsplatz zu
finden. Deshalb parke ich wieder auf einem Abstellplatz an der
Küstenstraße. Es herrscht so gut wie kein Verkehr. Ich glaube, in
der Nacht fuhren zwei oder drei Wagen vorbei. Ich rappele mich
beizeiten auf und lande in den frühen Morgenstunden nach einer
dreitägigen und 560 Kilometer langen Fahrt wieder in der Bucht
unterhalb Osani am Golfe de Porto. Was für eine wunderschöne Insel!
nach unten
nach oben
Am Pfeilerfelsen
Das Meer
ist ruhig.
Die Sonne scheint, als hätte sie etwas nachzuholen. Gegen halb elf
stecke ich im Taucheranzug und stapfe mit der Unterwasserkamera ins
Wasser. Die ersten Meter sind enttäuschend. Sollte auch dieser von
steilen Felsen gesäumte Golf der seichten Bucht von Argentella
ähneln? Rechter Hand, vielleicht 100 Meter weiter draußen, ragt ein
Stein mit der Silhouette eines winzigen Schlachtschiffes aus dem
Meer. Ich schnorchele hinaus. Es wird allmählich tiefer. Der
Seeboden bleibt aber immer gut erkennbar. Der Fels trug
wahrscheinlich einen Pfeiler mit einem nautischen Kennzeichen. Reste
eines Gittermastes liegen am Grund. Ich wechsele auf Geräteatmung
und lasse mich sinken. Mir wird heiß, aber nicht nur wegen des guten
Kälteschutzes meines Unisuits.
Ganz sacht,
immer etwas Druckluft über das Brustventil in den Tauchanzug
lassend, schwebe ich in die Tiefe. Es ist fantastisch. Endlich eine
Unterwasserwelt, wie ich sie mir für das Mittelmeer erhoffte. Klares
blaugrün schimmerndes Wasser. Zerklüftete und reichbewachsene
Gründe. Viele interessante Tiere. Allein schon der Pfeiler: Beläge
aus allerlei Pflanzen und niederen Tieren überziehen das Gestein.
Eine leuchtend rote Purpurrose. Weiße Seepocken, das sind sesshaft
in einem Kalkgehäuse lebende Kleinkrebse, fischen mit winkenden
Bewegungen nach vorbeitreibendem Plankton. Grünliche und bräunliche
Algen. Schwarze Miesmuscheln, Schwämme, Seescheiden. Röhrenwürmer
mit blütenförmig entfalteten Tentakeln. Krustenanemonen. Wie ein
Breitwandfilm zieht die mediterrane Fauna und Flora vor meiner
Tauchermaske vorbei. Ich stoppe den Abstieg bei einer Gruppe von
nach unten
nach oben
Röhrenwürmern
Im Mittelmeer leben mindestens 300 Borstenwurmarten, die zu
insgesamt vier Ordnungen gehören. Die meisten Borstenwürmer, eine
Klasse der Ringelwürmer, finden sich in den Ordnungen der
Freilebenden (Errantia) und der Sesshaften (Sedentaria). Letztere
hausen fast ausnahmslos in selbstgebauten Röhren oder in mit
Körperausscheidungen verfestigten Gängen. Deshalb nennt man die
Sedentarier oft auch Röhrenwürmer.
Bekannte und
auffällige Errantia europäischer Küsten von der westlichen Ostsee
bis zum Mittelmeer sind beispielsweise Borstenwürmer aus den
Familien der Eunicidae und Nereidae. Die oft räuberisch lebenden
Euniciden tragen aber auf dem Rücken kaum Borsten und sind mit
wehrhaften Kieferapparaten ausgestattet, mit denen sie schmerzhaft
zu beißen vermögen.
Die überaus
borstigen und stark segmentierten Nereiden sind häufig hübsch
gefärbt und zwischen 10 und 50 Zentimeter lang. Die Berührung
einiger Arten ist gefährlich. Etliche Nereiden besitzen außer
scharfen Kiefern mit Glaswolle vergleichbare Borsten, die sie bei
Gefahr spreizen. Die Borsten dringen leicht in die Haut und brechen
ab, das führt zu schmerzhaften Schwellungen und Entzündungen.
Unter den
Sedentariern sind zwei Familien besonders auffällig: die
Kalkröhrenwürmer (Serpulidae) mit dem Kleinen Kalkröhrenwurm, dem
Blutroten Röhrenwurm und dem Dreikantwurm und die Fächerwürmer (Sabellidae).
Die Kalkröhrenwürmer fertigen sich ihre Wohnröhren aus
abgeschiedenem Kalk und können diese mit einem konischen Horn- oder
Kalkzapfen verschließen. Die oft größeren Sabellen bauen bis zu
60 Zentimeter lange häutige oder hornige Wohngehäuse und stets ohne
„Tür“, also ohne Zapfen.
An den
unscheinbaren Wohnröhren würden die meisten Taucher vorbeischwimmen,
ragten da nicht wie Blüten aussehende farbige Tentakelfächer aus den
Mündungen. Es sind dies die Planktonfallen der Würmer. Zufällig in
das Strahlengeflecht geratene organische Schwebeteilchen werden
festgehalten und mit Flimmerhärchen entlang einer Rinne in die
Mundöffnung gestrudelt.
Die größten
Mittelmeersabellen sind der gewöhnlich mit seiner Röhre nur wenige
Zentimeter aus dem Boden ragende Pfauenfederwurm und die prächtige
Schraubensabelle. Bei der letzteren ist der Tentakelträger
spiralförmig gewunden.
Freilich,
all das geht mir nicht gerade in dem Moment, da ich die Röhrenwürmer
betrachte, durch den Sinn. Erst viel später habe ich darüber
nachgelesen. Mir genügt momentan eine grobe Einordnung.
Interessanter erscheint mir zu wissen, warum Röhrenwürmer herrliche
Tentakelkronen entfalten oder die meisten Arten zu Kletterhaken
umgebildete Borsten besitzen, mit den ihre Hinterteile in der Röhre
ankern. Das erlaubt ihnen bei Gefahr ein rasches Zurückschnellen.
Was prompt geschieht, als ich der Gruppe zu nahe komme. Plopp und
noch einen Zapfen vor den Eingang! Übrig bleiben ein paar
unscheinbar geschlängelte Strukturen.
Ich lasse
mich weiter sinken. Tiefe 10 Meter. Zwei bräunlich schimmernde
Purpurseescheiden. Im Scheinwerferlicht würden sie sich in
leuchtendem Rot präsentieren, doch die Wasserschicht eliminierte
bereits die roten Farbanteile des Sonnenlichts. Tiefe 15 Meter. Ich
lande auf dem Grund und genieße die Kulisse. Mannshohe Steinbrocken
bedecken den Boden und bilden kleine reizvolle Schluchten, Gänge und
Vertiefungen, von streifigem Licht erhellt. Wie ein
überdimensionaler Mast ragt die Felsnadel empor. Ein
Mönchsfischschwarm flirrt um den Gipfel gleich einer Wolke aus
groben Partikeln. Die Wasseroberfläche schimmert wie mattes welliges
Silber.
Nur wenige
Meter weiter lauert zwischen den Steinen in schräg aufwärts
gerichteter Haltung ein Pärchen Schriftbarsche von etwa 20 bis 25
Zentimeter Größe. Typische Kennzeichen der Schriftbarsche sind ein
leuchtend hellblauer Fleck an der Bauchseite und dunkele
Querstreifen; sie sollen an Schriftzeichen erinnern. Mir fällt es
schwer, da Ähnlichkeiten zu erkennen. Das Schriftbarschpärchen
betrachtet gelassen die Verrenkungen des Unterwasserfotografen samt
aufdringlichem Geblitze. Normalerweise sind Schriftbarsche
Einzelgänger; sie bewohnen ein genau abgegrenztes und gegen
Artgenossen verteidigtes Revier. - Nur zu schnell ist der Film voll
und die Batterie leer. Ich tauche auf und schnorchele zurück.
Filmwechsel und Einbau
des Normalobjektivs. Probeblitz. Nichts. Blitzgerätewechsel, das
heißt, den in Argentella gebadeten Blitz wieder angebaut.
Probeblitz. Okay! All dies im warmen Tauchanzug bei Sonne und
mindestens 22 Grad Celsius. Ich bin also auch aus thermischen
Gründen froh, als mich endlich wieder kühles Wasser umspült. Bei
diesem Tauchgang finde ich etwas abseits der Felsnadel zwischen
Neptunsgras eine bratpfannenbreite und halbmeterhohe Steckmuschel -
jetzt könnte ich das soeben ausgebaute Weitwinkelobjektiv
gebrauchen! Tauchende Souvenirsammler haben die einst häufigen
Muscheln recht selten werden lassen. Zwischen Schale und Mantel
dieser Mollusken haust oft ein Muschelwächter genannter
Kurzschwanzkrebs. Das kugelförmige Tier hat es nicht weit bis zum
gedeckten Tisch. Es kehrt sich einfach schleimumhüllte
Nahrungsteilchen von den Muschelkiemen. Ich treffe auch wieder auf
einen fast halbmetergroßen Eisseestern. Natürlich gerade jetzt, wo
sich ein Zwischenring nur für Aufnahmen von 20 Zentimeter großen
Objekten in der Kamera befindet.
Unter Wasser
vergeht die Zeit wie gewöhnlich viel zu schnell. Mein Rücken beginnt
zu schmerzen. Das kommt von dem Bleigurt an der Taille. In der
Schwimmlage zerrt seine Masse von immerhin 15 Kilogramm bauchwärts,
während Beine, Arme und Oberkörper durch den Auftrieb emporstreben.
Mein Atemluftvorrat geht zur Neige. Ein Blick auf den Kompass.
Gemächlich flössele ich zum Ufer.
nach unten
nach oben
Tauche nie alleine!
Sachkundige
werden vielleicht nach Grundsätzen der Tauchsicherheit fragen,
werden mahnend anmerken, dass es doch heißt: „Tauche nie allein!“ -
Ich hatte das eigentlich auch nicht im Sinne, sondern eine Basis mit
Boot und Tauchführer. Es hätte mir überdies die Suche nach
geeigneten Tauchplätzen erspart. Aber was, wenn man zum ersten und -
wer weiß das - vielleicht zum letzten Male an einem seiner
Traummeere sitzt? Nicht tauchen wegen des größeren Risikos? Wer das
über das Herz brächte, scheint mir, ist nicht mir Leib und Seele
Sporttaucher. Also allein, aber keine riskanten Tauchgänge und
bestmögliche Sicherheitsmaßnahmen beachten: Nur in Buchten und in
Ufernähe tauchen. Nicht tiefer gehen als 15 bis 20 Meter. Eine
stabile Boje mit einer 25 Meter langen Leine um die Taille
schlingen, damit einem notfalls jeder Sonntagsangler hochhieven
kann.
Als ich
wieder einmal nach Calvi fahre, um Luftvorräte und Brot einzukaufen,
entdecke ich etwa vier Kilometer südlich des Ortes eine
Straßennische zum Parken. In der Nische läuft ein Quellwasserrinnsal
den Fels hinab. Es ist genießbar; Korsika ist berühmt für gutes
Trinkwasser. Aber wichtiger ist: Unterhalb der Straße führt die
Andeutung eines Trampelpfades hinab zum Meer. Ob ich nicht doch
einen Tauchgang direkt an der Steilküste riskiere?
Ich erledige
die Besorgungen, trinke an der Hafenpromenade einen Pastis und
nächtige im Auto in der Straßennische. Die Nacht erweist sich nach
der gestrigen Kälte nun wieder als angenehm temperiert. Was für ein
sprunghaftes Wetter.
Am Morgen
interessieren mich vor allem zwei Dinge: ein großer Topf Kaffee und
der Weg hinab zum Meer. Das erste ist unproblematisch. Auch der
Abstieg lässt sich anscheinend ohne spezielle Bergausrüstung
leidlich bewältigen. Ich rutsche, kraxele, springe. Die Zeit
vergeht. Die Wasseroberfläche rückt kaum näher. Mir kommen bald die
trügerischen Bilder aus dem Pirin-Gebirge und der Hohen Tatra in den
Sinn Wie greifbar nahe schienen die Gipfel. Sie lockten wie Oasen in
der Wüste. Sie lockten Stunde um Stunde.
Nach etwa
drei Viertel des Weges gebe ich auf. Es ist zu weit für den
Transport der schweren Ausrüstung. Also zurück an den Golfe de
Porto.
Von der
offenen See her schieben sich lange Wellen in die Bucht. Die
Wasserbewegungen schlagen durch bis auf den 15 Meter tief liegenden
Meeresboden. Der Wellenrhythmus lässt alles Bewegliche über den
Grund schwingen: Sedimente, die pfenniggroßen Scheiben zerfallener
Schirmalgen, kleine Fische, Seegrasfetzen, Taucher. Das
Fotografieren wird schwierig. Die Sicht ist schlechter als gestern,
nur zehn bis zwölf Meter. Nur? Für die Ostsee wäre dies eine
begeisternde Traumsicht. Wie schnell man sich doch an bessere
Bedingungen gewöhnt. Mehr Fischschwärme als sonst durchstreifen das
Areal. Suchen sie Schutz in der Bucht? Endlich gelingt die Aufnahme
einer Steckmuschel. Wer übrigens meint, die Muschel stecke lose im
Boden, der irrt. Sie hat ihr spitzes Ende mit Byssusfäden auf einer
festen Unterlage angeheftet. Diese als Muschelseide bezeichneten
Fäden wurden in vergangenen Zeiten versponnen und zu Handschuhen
verarbeitet. Ein Paar dieser hauchzarten goldbraunen Handschuhe
passten in eine Walnussschale.
Ich halte
mich beim Fotografieren manchmal an Wurzelstöcken des Neptunsgrases
fest oder verklemme meine Beine zwischen Steinen. Eine der
merkwürdigen Ballalgen rollt über den Grund. Sie misst etwa
15 Zentimeter im Durchmesser und ist von satter dunkelgrüner
Färbung. Die Kugel fühlt sich elastisch an. Sie ist hohl und besteht
aus unzähligen miteinander verklebten Einzelfäden. Ich löse in jenem
Moment aus, da der Vorwärtsschwung endet und alle beweglichen
Objekte für einen kaum merklichen Augenblick verharren.
nach unten
nach oben
Schwämme
Unaufhaltsam
verrinnt mit der Blasenspur aus dem Atemregler die mögliche
Tauchzeit. Keine fotografischen Höhepunkte; ich fülle den Film mit
allerlei Stillleben, besonders mit Aufnahmen von Schwämmen. Es gibt
kaum harte Untergründe, auf denen keine Schwämme siedelten. Im
Mittelmeer leben über 180 Arten. Schwämme besitzen vielerlei Farben
und Formen. Röhren, Nieren, schichtartige Beläge, Stifte, Bälle,
Becher, mit bizarren Verästelungen besetzte Knollen, Geweihe . . .
Schwämme sind Tiere, sehr einfache, die simpelsten unter den noch
mit bloßem Auge sichtbaren marinen Lebewesen, aber eben doch Tiere.
Eines der wesentlichsten Merkmale tierischen Lebens ist Bewegung.
Schwämme aber rühren sich um keinen Deut. Selbst als ich sie
anstupse, erfolgt keine sichtbare Reaktion. Ich wiederhole einen
bekannten Versuch und zerbrösele Algenteilchen dicht über einer der
für Schwämme typischen Ausströmöffnung. Die Partikel werden
weggetragen; aus den Öffnungen strömt also Wasser. Folglich ist auch
irgendein Triebwerk in Gang, der Schwamm also doch nicht ohne Leben.
Ein
Schwamm mit dem Volumen von
einem Liter vermag täglich bis zu 2000 Liter durch die Poren seiner
Oberfläche zu saugen und wieder auszustoßen: 20 Bierfässer voll
Wasser! Die Schwämme sind von einem mit winzigen Einströmöffnungen
beginnendem System feinster Kanäle durchsetzt. Diese münden zu
Tausenden in den großen Ausströmöffnungen. In einem Teil der Kanäle
befinden sich Kragengeißelzellen. Ihre Millionen unablässig
peitschenartig schwingenden Geißelfäden treiben das Wasser durch den
Schwamm. Und mit dem Wasser zirkulieren Sauerstoff und Nahrung,
werden die Abfallprodukte des Stoffwechsels und die Keimzellen der
meist zwittrigen Schwämme ins Wasser gespült.
Aus den
Keimzellen entstehen rundliche bis ovale „Schwärmlarven“ mit
Geißelantrieb. Sie setzen sich nach einer Frist planktischen Daseins
auf einem harten Untergrund fest - egal ob Fels, Muscheln,
Wrackteile, Strünke großer Algen oder Krebspanzer. Es bilden sich
die ersten Kanäle mit Kragengeißelzellen. Sie werden ausgebaut.
Skelette aus miteinander verflochtenen Kalk- oder Kieselsäurenadeln
oder hornartigen Fasern aus so genanntem Spongin entstehen. Der
Badeschwamm ist nichts anderes als das nach dem Auswaschen lebender
Zellen übriggebliebene Spongingerüst. Unsere Schwämme im Haushalt
bestehen jedoch meist aus Kohlenwasserstoff-Verbindungen und kommen
in Leuna oder Leverkusen zur Welt.
Wenn ich es
recht bedenke und noch die Beobachtungen und Fotos hinzufüge, die
später vor Sardinien und Ibiza entstanden, so bestimmen Schwämme mit
teils prächtigen Färbungen wesentlich das Colorspektrum
unterseeischer Landschaften. Sie sind alles andere als fotografische
Lückenbüßer.
Momentan
fällt mir besonders der rote Schwamm Spirastrella cunctatrix auf mit
seinem typischen Adergeflecht großer Kanäle, eine gelbliche Knolle
mit Auswüchsen wie Warzen und ein nierenförmiger Lederschwamm von
graubrauner Färbung mit weißlichen Flecken. Schwämme sind durch die
oft variierenden Farben und Formen schwer zu bestimmen: teils nur
mit Lupe und Mikroskop nach der Form der Skelettnadeln. Schwämme
können sehr interessant sein, aber eines sind sie keinesfalls,
nämlich aufregend!
nach unten
nach oben
Muränen
Doch
Fortuna schüttet
gütig aus ihrem Füllhorn einen glücklichen Zufall auch zu mir herab
in den Golf. Als ich um einen Steinblock biege, starre ich in das
aufgerissene Maul einer Muräne.
Seit Kaiser
Nero (oder Sienkiewiczs „Quo vadis?“ bzw. dessen Verfilmung)
besitzen Muränen eine üblen Leumund: Sie fressen Menschen! Wer
erinnert sich nicht der Szene, da Nero seine Muränen mit nackten
Sklavinnen füttern ließ? In die Enge getriebene Muränen greifen
tatsächlich entschlossen an. Mit ihren nadelförmigen nach hinten
gebogenen Zähnen reißen sie schmerzhafte Wunden, in die außerdem
giftiger Schleim aus der Mundhöhle gelangen kann. Mir wird etwas
bang zu Mute.
Meine
Bedenken haben allerdings einen anderen Grund: Sporttaucher
berichten, dass sich manche Muränen, wenn ihnen der
Unterwasserfotograf zu dicht auf den Leib rückt, in ihre
Schlupfwinkel zurückziehen. Und wie käme ich dann zu einem Foto?
Andere
Ängste sind unbegründet. Man darf nur nicht in Muränenhöhlen fassen,
das Tier angreifen, packen oder gar harpunieren, so dass es sich
ausweglos bedrängt fühlt. Auf manchen Tauchbasen gehört die
Schaufütterung meterlanger Muränen durch den Tauchführer zum
Besichtigungsprogramm. Die gefräßigen Tiere jagen sonst überwiegend
nachts. Fische, größere Krebse und Tintenfische sind ihre Beute. Am
Tag verlassen Muränen nur ungern die Schlupfwinkel, stecken aber oft
interessiert den Kopf aus dem Eingang. Im Mittelmeer lebt nur eine
Art. Von den anderen hier anzutreffenden Aalfischen (Flussaal,
Meeraal) ist sie leicht zu unterscheiden: an der Fleckung und der
dicht hinter dem Kopf beginnenden Rückenflosse. Das offene Maul ist
keine gegen mich gerichtete Drohung, sondern normales Verhalten des
Tieres.
Ein
Naturführer meint: „Die Begegnung mit einer Muräne ist immer der
Höhepunkt eines Tauchgangs.“ Ich richte die Unterwasserkamera auf
den Höhepunkt. Er lugt, von Pfennigalgen umkränzt, aus einem
meterbreiten Rasenkorallenpolster. Bedingt durch das
Weitwinkelobjektiv und den minimalen Aufnahmeabstand von einem
halben Meter wird das wieder eine Aufnahme mit viel Biotop.
Nach 70
Minuten tauche ich auf. Die Wellen scheinen größer geworden zu sein
- Vorboten eines Wetterumschwungs? Ich habe aber nicht die
geringsten Schwierigkeiten. Mit dem leicht aufgeblasenen Anzug
schaukele ich wie eine Boje seelenruhig an der Oberfläche. Ich
schwimme zum Ufer und wechsele eilig Film und Objektiv. Die
restliche Druckluft soll für den Abend bleiben. Deshalb schnorchele
ich weiter, nun rechts am Ufer entlang mehrerer kleiner
Felsabstürze. Im Algenbewuchs der Gezeitenzone weiden Napfschnecken.
Jede Schnecke hat ihren festen Wohnplatz. Sie kehrt immer wieder
dahin zurück. Nicht ohne Grund: Die Napfschnecke ätzt sich durch
Ausscheidungen eine kleine Grube im Gestein, in die sie mit ihrem
napfförmigen Gehäuse genau hineinpasst wie ein Deckel. So ist die
Napfschnecke ideal geschützt gegen die Unbill ihres Lebensraume:
starker Wellenschlag, den Wechsel zwischen Überflutung und
zurückweichendem Wasser, manchmal völlige Trockenheit und
stundenlang sengende Sonne. Mich erstaunt immer wieder, wie
hervorragend sich die meisten Tiere und Pflanzen ihrer Umgebung
anzupassen vermochten. Biologen betrachten das gewiss nüchterner und
haben allerlei Erklärungen mit -ion zur Hand: Mutation, Selektion,
Evolution . . . Ich akzeptiere Theorien und Beweise, warum auch
nicht. Dennoch: Es sind auch kleine Wunder!
nach unten
nach oben
Sammler
Jede Zone
hat
ihre speziellen Bewohner, die sie nur notgedrungen oder gar nicht
verlassen. Als die typischsten Tiere der Gezeitenzone des
Mittelmeeres gelten die Gewöhnliche Napfschnecke und die Purpurrose.
Es ist meist nicht schwer, Purpurrosen zu finden, wenn man sie in
ihrem bevorzugten Biotop sucht - an glatten senkrechten
Felsabstürzen. Ich sehe die ersten Rosen schon von weitem. Sie
kleben wie halbierte Tomaten an dem Gestein. Neben den roten gibt
es, freilich seltener, auch braune und grünliche Färbungen. Im
Schwarzen Meer sah ich öfter braune Varianten, im Mittelmeer nicht
eine. Die im Durchmesser vier bis sechs Zentimeter großen Anemonen
entwickeln ihren Nachwuchs im Magenraum und entlassen dann die
Jungtiere durch die Mundöffnung in die See. Ich schnorchele an den
Felsen entlang. Bis auf ein Napfschneckenfoto gelingt keine
Aufnahme. Im freien Wasser schwimmend, ohne festen Halt und von den
Wellen auf- und abgeschaukelt - wie soll man da die Kamera vor dem
Motiv auf den Zentimeter genau ausrichten?
Ich biege
ins Areal der Seegraswiesen ab und schwimme strandwärts. Das
Neptunsgras bleibt zurück. Kleine, mit allerlei Kalkrotalgen und
Grünalgen bewachsene Steine bedecken den Grund. Unter mir hat ein
leuchtend roter Purpurstern seinen schützenden Unterschlupf
verlassen. Das schöngefärbte, auffällige Tier passt so gar nicht in
diese Umgebung schlichter zarter Töne. Er sieht eher aus wie ein
Dekorationsstück für den Fotografen. Schneckenlangsam kriecht der
Seestern auf Hunderten von Saugfüßchen voran. Ich mache drei Fotos,
ehe ich ihn behutsam anhebe. Der Seestern spannt seinen
Körpermuskulatur an und erstarrt. Ich setze das Tier zurück auf den
Grund und widerstehe der Versuchung, es als Andenken mitzunehmen.
Zu oft schon
haben Sammler die Natur geschädigt! Selbst die Mitnahme eines leeren
Scheckenhauses bedeutet letztlich einen Eingriff in das biologische
Gleichgewicht des Meeres. Ein Beispiel: im Mittelmeer leben ungefähr
15 Arten von Einsiedlerkrebsen, vom kleinen Sandeinsiedler mit
8 Millimeter Rumpflänge bis hin zum 60 Millimeter langen Großen
Einsiedlerkrebs. Diese Kurzschwanzkrebse haben ein zarthäutiges
Hinterteil, abgesehen von dem zu einem Greifhaken umgebildeten
Schwanz. Um den delikaten Achtersteven vor hungrigen Mäulern zu
schützen, schlüpfen nun die Einsiedler rücklings in leere
Schneckenhäuser. Sie werden ständig mit herumgetragen und, falls zu
eng geworden, gewechselt. Vielleicht äugt aus einem Versteck schon
interessiert einer der Einsiedler nach gerade dem Gehäuse, das ich
hinter der Handschuhstulpe verschwinden ließe?
Vom Handel
mit seltenen Schneckengehäusen für betuchte Sammler gar nicht zu
reden. Die kostbarsten Stücke wurden fast mit Gold aufgewogen. Das
führte praktisch zur Ausrottung manch seltener Art. Der Kauf bei
Zoo- und Souvenirhändlern ist ja nichts anderes, als fischte man die
Tiere selbst aus dem Meer - ganz egal aus welchem Meer! Ich fische
also nichts und schwimme zurück ans Ufer. Lediglich aus weit auf den
Strand geworfenen Überresten mariner Fauna werde ich später einige
Molluskenschalen und die Skelette dreier Steinseeigel auflesen;
diese, ein gewaltiger Pinienzapfen und ein Stück Korkeichenrinde
sind meine ganzen Souvenirs.
Gegen Abend
wird es immer stürmischer. Dicke Wolken verhängen den Mond. Nebel
kommt auf. Um 18.30 Uhr ist es stockfinster. Das Meer wogt
grauschwarz und rauscht beängstigend. Nebelschwaden wallen über die
einsame Bucht. Jetzt allein da hinaus? Ich mixe einen Grog - und
streiche den Nachttauchgang.
nach unten
nach oben
Die Tage
schwinden
dahin
wie die Francs im Portmonee. Unversehens geht beides zu Ende. Der
vorletzte Morgen dämmert herauf. Er verspricht noch einmal schönes
Wetter. Auch das Frühstück gelingt vorzüglich und erreicht die Güte
eines Imbisses am heimischen Bahnhofskiosk. Schwierigkeiten bereiten
lediglich die Fotografierversuche in der Brandungszone. Nach einigen
Minuten bin ich es leid, Spielball der Wellen zu sein und schwimme
in tieferes Wasser. Wieder ein herrlicher Tauchgang am Pfeiler. Noch
einmal bestaune ich den schönen Bewuchs, genieße die scheinbare
Schwerelosigkeit, das Gleiten über Blockgründe und Seegraswiesen,
folge Brassenschwärmen. Im Seegras entdecke ich eine faustgroße
Purpurschnecke. Die Purpurschnecke und die verwandte
Brandhornschnecke waren die wichtigsten Murex-Arten, die vor dem
Chemiezeitalter für die Gewinnung des begehrten Purpurs gesammelt
wurden. Die Färber benötigten riesige Mengen: für einen einzigen
Mantel immerhin etwa 12 000 Schnecken! Ein Lippfischporträt gelingt.
Und dann entdecke ich noch ein Tier, nach dem ich bisher vergeblich
Ausschau hielt: die Schraubensabelle, den größten Röhrenwurm des
Mittelmeeres. Die Wohnröhre steht aufrecht wie ein Schlot in einer
Spalte. Ich kann dadurch schlecht fotografieren. Immerhin bleibt die
Freude, eine der eigentlich - oder einst - häufigen Sabellen in der
Natur gesehen zu haben.
Ich
frühstücke in Ruhe, als begännen gerade die Ferien. Ich schaue auf
die blaue See und denke an all die Erlebnisse und Eindrücke auf
meinen Tauchgängen. Nein, das Mittelmeer ist noch nicht tot,
wenigstens nicht vor Korsika und in etlichen anderen Regionen. Aber
Tatsache ist, dass es schon viele Seegebiete mit hochgradigen
Verschmutzungen gibt und dadurch einen Rückgang im Artenreichtum:
Buchten, die im Sterben liegen; Meeresgründe, auf denen sich kaum
noch ursprüngliches Leben regt. Wenn vor allem die Anliegerstaaten
die Einleitung von Schadstoffen nicht drastisch vermindern, sind
eines Tages meine Unterwasseraufnahmen nicht nur Erinnerungsfotos,
sondern Dokumente ausgelöschter Lebensformen . . .
Den Gedanken
- dagegen ist ja die heimatliche Ostsee der reinste Zoo! angesichts
„leerer“ Tauchgründe in der Bucht von Argentella - muss ich
natürlich revidieren; würde man zum ersten Mal in die Ostsee
hinausschwimmen mit einem Weitwinkelobjektiv für halbmetergroße
Motive, was gäbe es da für Tiere zu fotografieren? Ich kenne die
heimischen Regionen durch viele Exkursionen, weiß um die sandigen
Gründe, die miesmuschelbewachsenen Steinblöcke, allerlei niedere
Tiere und ein Dutzend Fischarten. Ich stelle mich bereits beim
Einstieg auf dieses oder jenes Motiv ein.
Natürlich
leben hier im Mittelmeer wesentlich mehr Arten, auch in Regionen, in
denen auf den ersten Blick „nichts los“ zu sein scheint. Die Natur
lässt keine leidlich akzeptablen Lebensräume ungenutzt. Aber da die
Flachküsten und Seegraswiesen kaum sichere Verstecke bieten, sind
ihre Bewohner meist gut getarnt. Sie leben oft im Sand vergraben
oder tragen wenigstens Sandfarben. Andere besitzen Färbungen des
Seegrases - wie die Grüne Samtschnecke - oder ähneln gar - wie die
Seenadeln - völlig der Gestalt dieser Pflanzen. Große auffällige
Tiere bekommt man hier selten zu Gesicht. Erst mit wachsender
Vertrautheit der spezifischen Fauna und ihrer verschiedenen Areale,
nach einigen Dutzend Tauchgängen vor Korsika, Sardinien und Ibiza,
hatten sich meine Sinne so weit geschärft, um auch in den
vermeintlich trostlosen Unterwasserwüsten Leben zu entdecken. Der
Reiz des Mittelmeeres beruht für Taucher weder auf dichtbesiedelten
Korallenriffen noch auf Großfischen, sondern vor allem auf einer
vielfältigen wirbellosen Tierwelt.
Ich verstaue
Topf und Kocher in einer Gummischüssel und schiebe diese unter den
Sitz. Also dann los. Ein letztes Mal durch Calvi. Im Supermarkt am
nördlichen Stadtausgang kaufe ich eine neue Thermosflasche,
korsischen Landwein und etwas Roquefort, einen würzigen korsischen
Schafskäse. In Sachen Käse ist Korsika autark. Aber auch leider eben
nur darin.
Nach L'Ile
Rousse biege ich auf die N 197 ab, um Bastia auf einer noch nicht
gefahrenen Route zu erreichen. So kann ich noch neue
Landschaftseindrücke gewinnen. Irgendwo in den Bergen habe ich
Schwierigkeiten mit den Kreuzungen und Wegweisern. Einmal endet die
Straße auf einem Feldweg, dann wieder auf einem gebäudeumstandenen
winzigen Platz. Ich entscheide, ihn für einen Gutsinnenhof zu
halten. Schließlich weist mir ein alter Landpfarrer den richtigen
Weg - und kommt gleich einige Kilometer mit bis zu seiner Kirche.
Am
Nachmittag erreiche ich den Hafenvorplatz von Bastia. Fährtickets
werden erst ab 19 Uhr verkauft. Also weiter die Straße an der
Ostküste entlang in Richtung Norden. Vielleicht komme ich noch bis
zum nördlichsten Zipfel Korsikas?
nach unten
nach oben
Au revoir,
Korsika
In der
Nähe Bastias reiht sich Ort an Ort.
Die Ufer sind dicht bebaut. Aber die Abstände zwischen den Dörfern
werden größer, die Küstenlinien immer schroffer. Nach fast 40
Kilometer fahre ich in die letzte Siedlung der Ostküste: Macinaggio.
Inzwischen hat sich der Himmel zugezogen. Der Wind fegt Gischt in
den Jachthafen. Masten pendeln über grauem Wasser. Es ist wieder
kalt, vielleicht noch zehn Grad Celsius. Auch an diesem
Küstenabschnitt fällt mir der rasche Wechsel zwischen Idylle und
Verfall auf. Wie überall sind die Gebäude nur selten weiß gekalkt.
Die meisten Farbanstriche besitzen eine bräunliche, ocker- oder
sandfarbene Tönung. Die Türen und Fensterrahmen sind gewöhnlich in
einem noch dunkleren Braun lackiert. Ich fahre zurück nach Bastia,
denn es ist zu spät und das Wetter zu unfreundlich für eine
Wanderung zum Cap Corse, dem nördlichsten Punkt der Insel.
In Bastia
schlendere ich vor dem Dunkelwerden durch die engen verwinkelten
Gassen am Hafen. Eigentlich hätte ich mir noch gern das Palais des
Gouverneurs angesehen, eine Zitadelle und als La Bastida Stadtkern
des einstigen genuesischen Bastia. Es beherbergt unter anderem das
Centre de Documentacion d'Archéologie sous-marine, eine Ausstellung
von Funden aus antiken Handelsschiffen. Taucher bargen sie aus dem
Meer. Doch das Museum schließt um 17 Uhr. Im hinteren Innenhof steht
der Turm des einst von Kommandant Lheminier befehligten
französischen U-Boots Casabianca. Kapitän und Boot spielten 1943
eine wichtige Rolle bei der Befreiung Korsikas. Wieder und
hoffentlich zum letzten Mal in ihrer bewegten Geschichte erhoben
sich die Korsen gegen die Besatzer und befreiten als die ersten in
Europa ihre Heimat durch einen Volksaufstand.
Ich kaufe
ein Billett für Passagier und Auto. Um 20 Uhr fahre ich den Wagen
auf das Hafengelände. Eine Stunde später legt das Fährschiff ab. Die
Lichter Bastias versinken im Achterwasser. Mir ist beklommen zu
Mute. Noch lange starre ich trotz schlechten Wetters in die schwarze
unruhige See, in die Richtung der Insel des Lichts. Au revoir,
Korsika!?
(Erlebt 1980-1982, Text auch in Norbert
Gierschner: „Nur
tauchen, schreiben, reisen, Teil I“, ISBN-978-3-937522-42-5)
nach unten | nach
oben | home | Inhaltsverzeichnis
Für
Bestellungen per E-Mail
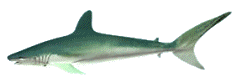
|


