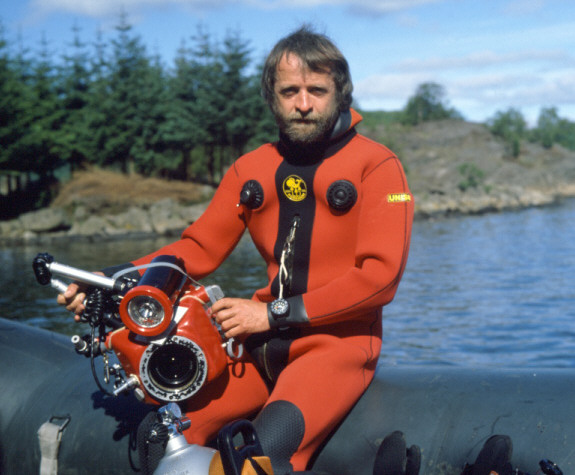Tauchergeschichten
Es könnte ja
sein, Sie interessieren sich auch für Natur- und
Taucherstories oder "Was hat der Gierschner denn da
geschrieben oder erlebt?" Hier einige Beispiele
Nachttauchen
- Mein
erster Abstieg im Helmtauchergerät -
Mein
erster Tauchgang im Mittelmeer -
Mein erster
Tauchgang in der Karibik
|
nach
unten
Klicken auf Bilder mit Hyperlinks erlaubt eine größere Darstellung,
retour via Browserbutton "zurück"
. . . und
weitere finden Sie auch auf allen anderen Seiten. Am besten
sehen Sie sich einmal das
Inhaltsverzeichnis
an!

Nachttauchen - Zeit ungewöhnlicher Begegnungen
Der Abend
kommt. Die Sonne steigt in ihren Pyjama aus rötlichem Flor
und bettet sich hinter dem Hochwald. Auch der Wind hat genug
von des Tages Müh und legt sich aufs Ohr. Leichtfüßig
huschen Dämmerung und Abendkühle heran. Alles geht zur Ruhe.
Nur der Mond verliert seine Schläfrigkeit, grinst bald breit
über sein helles Gesicht: Es wird Nacht.
Der See liegt
glatt wie Asphalt. Schwarze unförmige Gestalten waten durch
die Schneise im Schilf. Eine Ente quarrt. Die Schemen
versinken im Wasser, gurgelnd zerplatzen Blasen an der
Oberfläche. Der Mond versteckt sein Gesicht hinter einer
dicken Wolke.
Die Gestalten
da unten scheren sich darum keinen Deut. Ein schmaler
Lichtkegel flammt auf. Dann zwei, drei, vier. Die
Strahlenbündel schwenken suchend
durch das Wasser, verharren, überschneiden sich, bilden für
Bruchteile von Sekunden flirrende Gitter, um sich im Nu
wieder aufzulösen. Kleine, rhythmisch blinkende Bojen
tauchen auf. Zweiergruppen mit je einer Boje im Schlepp
verschwinden in der Tiefe des Sees. Der Wasserspiegel
glättet sich. Die Schneise täuscht wieder Unberührtheit vor.
Lediglich das große weiße Auge einer starken Lampe strahlt
durch das Gelege, bewacht von einer einsamen Gestalt. Die
Ein- und Ausstiegsstelle. Fröstelnd schaut die Gestalt auf
die Leuchtziffern ihrer Uhr. Zehn Minuten nach 22 Uhr.
Nachttauchen,
das bedeutet normalerweise eine Abkehr von dem Anblick des
gewohnten Milieus: helle, lichtdurchflutete Pflanzenhaine
aus Laichkraut, unterseeische Wiesen von
Armleuchtergewächsen, kahle, dämmerige Gründe. Nachts
schrumpfen die Dimensionen. Die optische
Wahrnehmungsfähigkeit reduziert sich auf den Lichtkegel der
Handlampe. Die körperlich Belastung ist die beim Tauchen
übliche, anders der Einfluss auf die Psyche.
Man schwimmt
langsam seewärts. Mit dem Partner verbindet einem die zwei
Meter lange, um den Oberarm geschlungene Sicherheitsleine.
Beruhigend, den Partner in der Nähe zu wissen, denn alles
ist so anders. Der Lichtfinger des Scheinwerfers streicht
über den Grund. Jenseits des Scheines liegt die Dunkelheit
wie schwarze Watte. Man weiß nicht, was da außerhalb des
engen Gesichtskreises geschieht. Kein gutes Gefühl. Bleich
und fahl schälen sich hohe Laichkrautranken aus der
Finsternis. Jeden Moment kann man Auge in Auge mit einem
riesigen Hecht oder Wels stehen. Hechte greifen keine
Taucher an, beruhigt man sich. Dennoch: Es bleibt die
Furcht, dass es etwas zu fürchten geben könnte.
Weiter geht es
ein Stückchen in den Laichkrautdschungel. Die Leine kommt
zwischen den Pflanzen unklar. Während man entwirrt,
versinken die Beine in Kraut und Schlamm. Natürlich zu
schwer tariert! Mudwolken wirbeln empor und trüben das
bisschen Sicht. Man hat Angst stecken zu bleiben, arbeitet
heftiger mit den Flossen als notwendig. Das Kraut legt sich
in Klumpen um die Beine, hängt am Messergriff. Man rudert
mit den Armen, kommt hoch. Endlich. Weshalb die Aufregung?
Was kann schon passieren? Rasch hat man Bewegungen und Atem
wieder unter Kontrolle. Man zeigt dem Partner im Lampenlicht
das vom Zeigefinger und Daumen geformte Okay-Zeichen. Alles
in Ordnung!
Ein Blick auf
die Instrumente. Tiefe drei Meter. Der Kurs stimmt noch. Man
folgt dem abfallenden Grund. Der Lichtkegel hüpft über junge
schlafende Flussbarsche und Plötzen, die im
Scheinwerferlicht erstarren. Vier, fünf, sechs Meter. Immer
wieder gleitet der Blick misstrauisch seitlich ab ins
Finstere. Ringsum und über einem nur undurchdringliche
schwarze Wasserschichten. Fürchtet man da könne plötzlich
ein noch unbekanntes Fabelwesen auftauchen? Aber das gibt es
nicht. Man weiß es ja. Weiß man es wirklich? Da. Ewas stößt
einem gegen die Brust, windet sich am Bein lang. Man zuckt
zusammen. Starrt. Nichts. Nur ein geblendeter Aal, der sich
in der Fluchtrichtung irrte. Nachttauchen, ein gutes
Training für die Psyche des Tauchers, für die Beherrschung
in unvorhergesehenen Situationen. Die Angst hier unten ist
eine natürliche Reaktion auf Gefahren. Tiere folgen in
solchen Situationen ihrem Instinkt, handeln nach erworbenen
oder angeborenen Verhaltensprogrammen. Anders wir, wir
können sinnvoll oder falsch reagieren und handeln.
Mutig ist nicht
der, der keine Angst hat, sondern der, der diese Angst durch
Vernunft und Können überwindet. Dazu ist Beherrschung
notwendig. Das Nachttauchen, beispielsweise, hilft uns bei
der Herausbildung solcher Fähigkeiten. Denn Augenblicke, in
denen uns die ganze Angelegenheit nicht ganz geheuer
erscheint, gibt es häufig. Namentlich, wenn man ganz allein
durch die Tiefe streift, etwa bei der einsamen Jagt mit der
Unterwasserkamera.
Die
ungewöhnliche Zeit und Situation gestatten ungewöhnliche
Aufnahmen. Die nächtliche Unterwasserwelt wird zum
Schauplatz seltsamer Begegnungen. Fische stoßen
 im
Lichtkegel aneinander. Der Barsch scheint den Aal zu
begrüßen. Plötzen beäugen uns. Der Flusskrebs scheint
neuerdings Fische fangen zu wollen. Andererseits: friedlich
stehen Todfeinde nebeneinander wie Hecht und Rotfeder. Und
anstatt zu flüchten, streben Hechte wie magisch angezogen
ganz langsam auf die Pilotlampe zu. Eine verkehrte Welt.
Auch in dieser Beziehung. Erst mit dem Ausschalten der Lampe
erlischt der Zauber. Der Feind wird wieder zu Feind.
Blitzartig machen sich die Rotfedern aus dem Mud, such der
Hecht das Weite. im
Lichtkegel aneinander. Der Barsch scheint den Aal zu
begrüßen. Plötzen beäugen uns. Der Flusskrebs scheint
neuerdings Fische fangen zu wollen. Andererseits: friedlich
stehen Todfeinde nebeneinander wie Hecht und Rotfeder. Und
anstatt zu flüchten, streben Hechte wie magisch angezogen
ganz langsam auf die Pilotlampe zu. Eine verkehrte Welt.
Auch in dieser Beziehung. Erst mit dem Ausschalten der Lampe
erlischt der Zauber. Der Feind wird wieder zu Feind.
Blitzartig machen sich die Rotfedern aus dem Mud, such der
Hecht das Weite.
Man blickt auf
die Taucheruhr. Es ist schon nach dreiundzwanzig Uhr. Wieder
einmal ist unmerklich und viel zu rasch die Zeit
verstrichen. Langsam kriecht die Kühle den Rücken hoch. Die
Luft strömt gleichmäßiger und leichter aus dem Automaten.
Ein Zeichen, dass der Luftdruckvorrat auf wenige bar
abgesunken ist. Gleich wird er zu Ende gehen. Man
verständigt sich und taucht auf. Die Lampen erlöschen.
Schlagartig liegt wieder alles im nächtlichen Dunkel.
Während die Taucher zurück ans Ufer waten, herrscht in den
unterseeischen Regionen schon wieder das übliche Treiben:
Schleie und Aale ziehen auf Nahrungssuche, Flussbarsche
schlafen, Plötzen und Rotfedern ruhen zwar, sind aber wieder
„auf dem Sprung“. Bleie stöbern im Grund, Flusskrebse tasten
nach Fressbarem. Und selbst der Hecht, dem man einst
nachsagte, er sei fast ausschließlich ein „Augentier“, holt
sich, wenn möglich, ein Nachtmahl.
Mitternacht.
Die gewöhnliche Ruhe ist zurückgekehrt. Der See liegt wie
nasser Asphalt. Eine Ente quarrt. Der Mond grinst breit.
Wieder.
P.S.: Die im
Text erwähnten Sicherheitsmaßnahmen basieren auf
Vorschriften, wie sie in DDR-Zeiten für die Tauchausbildung
im Rahmen der Gesellschaft für Sport und Technik vorgesehen
waren. Und wie üblich, die wenigsten wurden befolgt...
nach unten
nach
oben
home
Inhaltsverzeichnis
Mein
erster Abstieg im Schweren Helmtauchergerät
Die Sache liegt
schon Jahre zurück. Doch neulich gerieten mir Fotos in die
Hand: Die Friedrich Ludwig Jahn, ihre Besatzung,
Taucher unserer Gruppe, ein Schweres Schlauchtauchergerät
und ich (sehr klein in einem viel zu großen Anzug) - Bilder
von meinem ersten Abstieg im „Schweren": Es war im Sommer
1968. Unsere Tauchsportsektion bekam die Gelegenheit, sich
an einer Ostseeexkursion mit Motorbooten des Berliner
Seesportstützpunktes zu beteiligen. Einige Tage später
wechselten wir auf die Friedrich Ludwig Jahn über.
Wir hatten Dusel. Die Motorboote mussten aus irgendwelchen
Gründen zurück, wir aber brauchten unsere Tour nicht
abzubrechen, sondern konnten unsere Fahrt als Gäste der
Marineschule der GST „August Lütgens" auf der Friedrich
Ludwig Jahn fortsetzen. Taucher sind eben Glückspilze.
Am zweiten Tag unserer Seefahrt zwang uns aufkommender Sturm
zur Zuflucht in einen Hafen im Rügener Bodden.
Naturgemäß war
die Sicht im Hafenbecken alles andere als rosig, nicht
einmal Schnorcheln lohnte. Wie die Zwangspause nützen?
Irgendeinem kam die Idee: Abstieg im Schweren Tauchergerät.
Wir waren begeistert. Es sollte keine ernsthafte
Ausbildungsstunde werden; wir wollten lediglich eine
Vorstellung von der Arbeit eines solchen Gerätes und der
Taucherpraxis erhalten, für jeden einige Tauchminuten im
Rachen. Alle gingen an die Arbeit. Anzug und Taucherhelm
erschienen aus der Taucherkiste,
die Luftpumpe wurde aufgestellt, der Schlauch
klariert. Mit jedem der herbeigebuckelten
Ausrüstungsgegenstände wurden wir stiller. Eigentlich
unheimlich, so ein Gerät. Und sagenhaft schwer. Schließlich
blieb nur noch die Frage offen: Wer taucht zuerst? Alles
druckste, einer schaute auf See, ein anderer musste mal. So
richtig geheuer war uns allen nicht. Und ich hatte am
lautesten für einen Einstieg mit diesem Gerät plädiert!
 

Die Pause nach
der Frage wurde immer peinlicher. Irgendwer sagte: Ich! Das
muss wohl ich gewesen sein. Denn unter großem Hallo
verfrachtete man mich in den viel zu weiten Anzug. Alles
fummelte und schraubte und schnürte an mir herum. Die halbe
Tagesproduktion eines mittleren Stahl- und Walzwerkes
schnallten sie mir an. Gusseiserne Schuhe, Rückengewicht,
Brustgewicht und was weiß ich noch. Damit meine Hände aus
den Anzugärmeln überhaupt herausschauten, wurden die
Manschetten umgeschlagen; von Dichtsitz konnte keine Rede
sein. Vorerst störte mich das nicht. Hilfsbereite Hände
stülpten mir das Kupferei über den Kopf. Freundlich
lächelnde Kameraden stürzten an die Pumpe. Der „Lange"
übernahm das Telefon, der Tauchlehrer die Sicherheitsleine.
Jemand schraubte das Bullauge zu. Plötzlich war ich ganz
allein in dem Gehäuse aus gummiertem Leinen und Metall.
Schlagartig dämpften sich die Geräusche der Außenwelt. Für
Bruchteile von Sekunden stieg Platzangst auf. Wenn die
Kameraden aufhörten zu pumpen? Dann müsste man in diesem
Futteral ersticken. Doch der beruhigende Luftstrom und ein
Rest Vernunft verdrängten rasch die Gedanken an Gefahr. Zum
Tauchen gehört einfach auch das Vertrauen zu den Kameraden.
Der
traditionelle Schlag auf den Helm bedeutete mir, dass alles
in Ordnung sei. Ich schleppte mich zur Leiter, stieg die
drei Stufen empor und drehte mich um. Gebückt unter der Last
der Gewichte und krumm geschnürt durch den Reitgurt, ging es
außenbords. Dann griff mir das Archimedische Gesetz
hilfreich unter die Arme. Erleichtert fühlte ich die Kräfte
der Massen schwinden. Eigentlich müsste ich nun durch
Kopfdruck das Auslassventil öffnen, um die Luftblase im
Anzug abzubauen und zu sinken. Völlig überflüssig. Da ich
die Arme noch hoch an der Leiter hielt, strömte die Luft
über die Ärmel ab. In dem Maße, wie der Signalmann Leine
gab, versank ich im grünlichen Dämmer.
Irgendwie kam ich unten
an. Der Anzug presste sich ungewohnt eng an die Beine.
Gurgelnd schoss Luft aus den Ärmeln. Instinktiv hielt ich
sie nach unten. So blieb wenigstens die Luft im Anzug. Dafür
stieg prompt das Wasser in den Ärmeln bis auf das Niveau der
Luftblase. Die Nässe wurde mir aber erst später bewusst,
denn zunächst hatte ich mit einer neuen Schwierigkeit zu
kämpfen. Ich war auf einer Böschung gelandet und konnte
keinen festen Stand finden. Ich begann bergab zu laufen.
Irgendwo musste der verflixte Hang ja zu Ende sein. Ich
fürchtete - so kurios
das
in Bezug auf
UW-Verhältnisse auch klingt - umzufallen. Ich sah schon die
Luftblase aus dem Oberteil in die Beine gleiten und
mich
mit
aufgeblähten Hosen und unten hängendem Heim nach oben
treiben. Ich wusste nicht, ob das möglich war. Zumindest
hatte ich, hangabstapfend, die Befürchtung.
Schon nach wenigen
Metern erreichte ich ebenes Gelände. Erleichtert blieb ich
stehen und zwang mich zur Buhe. Es war doch alles in
Ordnung! Weg mit den Gedanken an all das angelesene Zeug von
gebrochenen Luftschläuchen, Absturztod, emporschießenden
Tauchern und einem Krakenangriff. Plötzlich begriff ich
auch, woher das undefinierbare Gekrächze kam, das mir die
ganze Zeit über in den Ohren gelegen hatte. Der „Lange"
erkundigte sich per Telefon nach meinem Befinden. Ich weiß
nicht mehr, was ich erwiderte, hoffe aber, dass es zünftig
klang: „Taucher auf Grund“, „Alles in
Ordnung“ oder so.
Zu sehen gab es absolut
nichts. Ich stand wie das einsame Männlein im Walde am Grund
herum. Meine Nase kribbelte. Die unwillkürliche Bewegung in
ihre Richtung endete am Taucherhelm. Ich versuchte, einige
Schritte zu laufen. Eine anstrengende Sache. Ich hatte wohl
auch zu lange das Auslassventil offen gehalten und verfügte
deshalb über zu viel Abtrieb. Die Stimme des „Langen“
beendete meine Bemühungen. „Wir holen dich jetzt hoch. Nicht
schießen lassen!“
Zur Erklärung:
Helm und Anzug bilden bekanntlich ein geschlossenes System,
in das ständig Luft hinabgepumpt wird. Die Luft beult bei
dem aufrecht stehenden Taucher den Anzug unterhalb des Helms
auf Brust und Rücken zu einer Blase aus. Lässt der Taucher
wenig oder keine Luft ab, vergrößert sich die Blase, der
Taucher gewinnt ständig an Auftrieb. Die größere Blase hat
natürlich auch einen höheren Druck als die kleinere. Je nach
Justierung springt dann früher oder später das
Luftauslassventil auf und lässt automatisch Luft ab. Durch
Zuhalten oder Verstellen kann der Auftrieb zu groß werden
und der Taucher fängt an, emporzutreiben. Abnehmender
Außendruck bedingt weitere Volumenvergrößerung und
Auftriebsgewinn. Zum Schluss „schießt“ der Taucher zur
Oberfläche. - Und das sollte ich vermeiden!
Ich ließ also
fleißig Luft ab. Resultat- Man musste mich wie einen Anker
emporhieven. Ich erreichte die Leiter und stapfte langsam
nach oben. Der erste Abstieg schien glücklich überstanden.
Aber irren ist menschlich! Das eigentliche Martyrium begann
auf der Leiter. Durch die der geschwungenen Bordwand
angepasste Form der Leiter musste man sich hintenüber
geneigt fast emporziehen. Und das mit den zig Kilo am Leib.
Irgendwie ging es aber. Was nicht ging, zeigte sich, als ich
ganz aus dem Wasser heraus war. Ich bekam die Beine mit den
schweren Schuhen und dem Wasser darin nicht mehr angehoben.
So sehr ich mich auch mühte, ich hatte nicht die Kraft, den
Fuß auf die nächst höhere Sprosse zu setzen. Da hing ich nun
zwischen Schiff und Wasser, schwitzend, keuchend, mit halb
ins Gesicht gerutschtem Pudel - und kam keinen Schritt
höher. Später sagte man mir, dass man mit Schwung das Bein
hochreißen und es förmlich auf die nächst höhere Sprosse
schleudern müsse, wenn es nicht anders geht. Später ist man
immer klüger. In diesem Moment aber dachte ich: Macht, was
ihr wollt, da komme ich nicht hoch. Schließlich enterte ein
mitfühlender Kamerad die Leiter herab. Er hing an der Seite,
fast auf gleicher Höhe mit mir und packte an dem jeweiligen
Taucherschuh an, während von oben kräftig gezogen wurde. Und
so gelangte ich mit vereinter Kraft wieder an Bord.
Damit wäre
schon alles über meinen ersten und leider auch einzigen
Abstieg im „Schweren“ gesagt. Nicht sehr rühmlich, aber
interessant. Und abgesehen von den technischen Details und
dem Gefühl, mal in einem dieser historisch doch so
bedeutungsvollen Tauchergeräte gesteckt zu haben, blieb auch
noch dies: die Achtung vor den Leistungen der Berufstaucher,
die in diesen Geräten auch noch schwere Arbeiten verrichten.
nach unten
nach
oben
home
Inhaltsverzeichnis
Mein erster Tauchgang im Mittelmeer: 1980, Korsika
Eines besonders
schönen Tages erhalte ich die Genehmigung zu einer Reise via
Westdeutschland und der Schweiz nach Frankreich, um
Informationen und Bildmaterial für Publikationen zu sammeln,
Tauchertechnik und Tauchfahrzeuge zu besichtigen und
Unterwasserfotos aufzunehmen. Ich tauche und fotografiere
seit 1958 und das Schreiben über Vorgänge im Reiche Neptuns
ist mein Beruf.
Wieder einmal -
wie fast jedes Jahr - demontiere ich den Beifahrersitz
meines Trabant-Kombi und stopfe in alle möglichen Winkel:
Taucherausrüstung, eine große Salami, drei Pentaconsix (am
Ende der Reise wird nur noch eine eingeschränkt
funktionieren), KFZ-Ersatzteile, 70 Farbfilme, Reiseführer,
Werkzeuge, Autokarten, Spaghettis, Flaschen mit Öl für
Zweitaktmotoren, Pullover, Konservenbüchsen, einem
Schlafsack und viele andere Dinge. Zu dem in Aussicht
gestellten Termin - Anfang August - sind alle Vorbereitungen
abgeschlossen. Lediglich der Pass und die Visa fehlen noch.
Die folgenden Wochen lebe ich zwischen gepacktem Auto und
Telefon. Die Salami wird routinemäßig alle drei Wochen
ausgetauscht. Der erlösende Anruf kommt kurz vor dem vierten
Salamiwechsel.
Ich verschließe
das Haus und fahre sofort los. Inzwischen ist es Anfang
Oktober geworden und damit Herbst. Die ursprünglich genau
aufeinander abgestimmten Routen und Termine müssen
umgestellt, das Mögliche vor Ort erkundet werden. Ich fahre
durch Westdeutschland in Richtung Basel, verweile fast drei
Tage in Zürich, besuche in Lausanne Dr. Piccard und reise
weiter über Genf nach Frankreich. Brav und zuverlässig
knattert der Trabant durch die Rhôné-Alpen und dann im
Rhônetal hinab nach Süden. Am Abend des 18. Oktober erreiche
ich in Marseille den südlichen Rand Europas: das Mittelmeer.
Die Tauchbasen
an der Côte d'Azur haben bereits geschlossen - Saisonende!
Deshalb entscheide ich mich, vor den anderen Arbeiten in
Marseille, zunächst die südlichste und damit wärmste Provinz
Frankreichs aufzusuchen: Korsika. Aus
Tauchsportzeitschriften weiß ich von einer bis Mitte
November geöffneten Basis in L'Ile Rousse; auch besäße
Korsika neben einer herrlichen Landschaft die schönsten
Tauchgründe Frankreichs. Das nächste Schiff nach Korsika
fährt am Montagabend. Zwei Tage verbringe ich ruhelos
zwischen Marseille und Toulon. Es gelingt mir nirgendwo -
außer an seichten Badestränden - zu einem ersten
Erkundungstauchgang ins Wasser zu gelangen. Jedes Fleckchen
Küste, das ich ansteuere, ist bebaut, eingezäunt, mit
Verbotsschildern als Privatbesitz gekennzeichnet. Als böse
Überraschung erweisen sich auch die horrenden
Autobahngebühren. Und schließlich stresst ein höllischer
Verkehr, besonders in Toulon und Marseille. Ich bin froh,
als endlich die Fähre ablegt. Die Nacht verbringe ich mehr
recht als schlecht in einem Liegesessel.
Aus dem Grün
der Insel schimmern rötliche Dächer. Mein Herz klopft
erwartungsvoll. Das vielterrassige Häusermeer Bastias schält
sich aus dem blauen Morgendunst. An Bord kommt Unruhe auf.
Ich steige in die Wagenhalle hinab. Um halbacht klirrt die
Fahrrampe auf den Kai.
Die Straße
zwischen L'Ile Rousse und Calvi ist neu und breit. Gleich
hinter dem Ortseingang steht das stattliche zweistöckige
Gebäude des französischen Tauchsportklubs GETS. Was mag das
Logis hier kosten? Finanziell ist für mich eigentlich nur
Camping möglich. Noch ehe ich es recht bedacht und einen
Parkplatz gesehen habe, ist die Stadt schon durchquert. Das
nächste mögliche Ziel wäre Argentella, Camp Morsetta. Da
stehen auch schon am Straßenrand schultafelgroße Aufsteller
mit diesem Namen. Je ein stilisierter Taucher und Surfer
werben für mögliche Lustbarkeiten. Also dorthin. Ich bin
wieder guter Laune und rase mit 20 km/h um die zahllosen
Kurven.
Als ich auf den
Zeltplatz einbiege, steht die Sonne nur noch eine Handbreit
über dem Meer. Die Rezeption und die Bar sind geschlossen.
Irgendwo maunzt kläglich eine Katze. Der Waschraum ist
offen. Zugluft raunt im Gebälk der dämmerigen Halle. Türen
klappen. Eine Brause läuft. Ich denke an einen gewissen
Hitchcockfilm und lenke den Wagen hinab an das Meer in
offenes, übersichtliches Terrain. Platz ist ja genug. Das
Camp ist absolut leer.
Der Morgen
dämmert. Gemächlich klimmt die Sonne hinter den Bergketten
empor. Eine Zinne glänzt mit einer Aureole auf. Die Pracht
ist von kurzer Dauer. Schon steigt die Sonne weiter. Ihr
Licht fließt hellgelb die Hänge heran und erreicht endlich
auch mich. Ein kaltes Bad? Frühsport? Ich setze den
Benzinkocher in Betrieb. Kaffee! Wieder einmal siegte die
angenehmste Variante der Muntermacher.
Anderthalb
Stunden später wate ich zum ersten Tauchgang durch das
feinkörnige Geröll hinab an das Wasser. Meine Fußspuren
haben groteske Dimensionen. Mutmaßungen, dies stehe in
gewissem Zusammenhang mit einem deftigen Frühstück, sind
leicht zu widerlegen. Die Schuhgröße 48 stammt von den
Stiefeln des Tauchanzuges. Von der augenblicklichen
Gesamtmasse mit rund 110 Kilogramm sind nur 58 Kilogramm
Körpergewicht, der Rest ist Tauchausrüstung. Ich quetsche
die Stiefel in die Schwimmflossen und stelze rückwärts ins
Wasser. Schon nach wenigen Schritten schwappt es um meine
Taille. Ich stecke den Kopf unter die Oberfläche - gespannt
auf all die Wunder warmer Meere. Ich wundere mich gründlich.
Das Wasser
schimmert blaugrün und ist sehr klar. Die Sichtweite beträgt
mindestens fünfzehn Meter, vielleicht mehr. Zu sehen ist
aber fast nichts! Ein kiesiger Ufersaum, Seeigel und eine
sich im Ungewissen der Ferne auflösende Posidoniawiese, so
genanntes Neptunsgras. Ich bin maßlos enttäuscht!
Ich tauche bis
zum Hals unter, hebe beide Arme knapp aus dem Wasser und
öffne eine Handgelenkmanschette. Rauschend entweicht Luft
aus dem Tauchanzug. Aber immer noch ist mein Auftrieb für
einen eleganten Abschwung zu groß. Ich plantsche wie ein
Anfänger und bin froh, keinen sachkundigen Zeugen am Ufer zu
wissen. Nur drei Hunde stehen mit schwer deutbaren Mienen am
Strand.
Die erste
Begegnung mit der Fauna des Mittelmeeres ist an Küsten mit
hartem Untergrund oft von bestechender Eindringlichkeit - im
wahrsten Sinne des Wortes. Schon stecken in irgendeinem
Körperteil Seeigelstacheln. Bereits in der Nähe des
Ufersaumes sehe ich Dutzende von Steinseeigeln. Sie leben
oft dichtgedrängt in Wassertiefen ab einem halben Meter und
bilden so einen gefährlichen Sperrgürtel, als gelte es, das
Meer gegen die Invasion der Zweibeiner zu schützen. Kommt
man den Steinseeigeln zu nahe, werden blitzartig die sonst
beweglichen Stacheln fixiert. Sie dringen in die Haut ein
und brechen ab. Nur mit Geduld, Nadel und Pinzette lassen
sie sich wieder aus der Haut entfernen. In Gesellschaft der
Steinseeigel leben die ähnlichen, aber weniger häufigen
Schwarzen Seeigel. Sie haben längere Stacheln und sind nie
bräunlich, sondern immer tief blauschwarz gefärbt. Ich drehe
mit dem Messer einen Steinseeigel um. Es ist ein schwarzer;
das weichhäutige Mundfeld nimmt - im Gegensatz zu dem
wesentlich kleineren des Steinseeigels - die Hälfte der
Körperunterseite ein.
Au! Jetzt habe
ich, beim Aufstützen am Grund, doch einen Steinseeigel
übersehen. Der Stachel lässt sich glücklicherweise mit dem
Fingernagel gleich herausschaben. Ich fotografiere die
Seeigel. Manche von ihnen halten mit ihren Saugfüßen
allerlei Pflanzenteile auf der Körperoberseite fest,
vielleicht zur Tarnung, vielleicht als Schutz gegen zu
starken Lichteinfall. Gelegentlich trägt ein Seeigel -
vielleicht ist es gerade der letzte Schick - aus dem Abfall
vom Meeresgrund auch einen Kronenkorken, den Ringöffner
einer Bierbüchse oder er hüllt sich in Grillfolie.
Als ich nach
mehreren Aufnahmen wieder einmal in die
Elektronenblitz-Frontscheibe schaue, um das Aufleuchten der
Bereitschaftsanzeige zu beobachten, sehe ich sofort, dass
sie kaum noch lange anzeigen dürfte. Das Gerät ist zwar ein
Unterwasserblitzer, doch Wasser sollte sich eigentlich nur
außerhalb des Gehäuses befinden.
Also zurück ans
Ufer. Das Blitzgerät ist schnell demontiert. Ein bisschen
Mittelmeer rinnt aus dem Gehäuse. Ich spüle mit Trinkwasser
die elektronischen Bauelemente und puste größere Tropfen ab.
Nötig wäre nun ein elektrischer Haartrockner, den
havariegeplagte Unterwasserfotografen im Handgepäck haben
sollten. Eine Havarie zu haben ist ja kein Problem, aber
einen Föhn? Ich lege das Gerät zum Trocknen auf das
Autodach.
Mit dem
Reserveblitz und einem zusätzlichem Kilogramm Blei stapfe
ich zurück ins Wasser. Die Seeigel sind nun fast schon alte
Bekannte. Der Grund wird steiniger. Ein „Braunalgenrasen“,
durchsetzt mit Trichteralgen, überzieht manche Blöcke und
Flächen. Die erste Wachsrose kommt in Sicht. Sie ist sicher
das auffälligste Tier im Flachwasser an mediterranen
Felsküsten. Sanft schwingen im Rhythmus der Wellen violett
abgesetzte Tentakel. Die Wachsrose ist mit einem Durchmesser
bis zu 12 Zentimeter und maximal 200 bis zu 20 Zentimeter
langen Armen die größte und häufigste Seeanemone des
Mittelmeeres. Entgegen der Angaben vieler Bestimmungsbücher
sah ich später zwischen Korsika und Sardinien öfter noch
viel größere Exemplare. Einmal schienen gar halbmeterlange
Tentakel wie gelbliches strähniges Wachs einen Fels
herabzurinnen.
Nur langsam
wird der Film voll. Zuletzt fotografiere ich aus Mangel an
anderen größeren Motiven Stillleben mit Algen und Schwämmen.
Ich schwimme recht unzufrieden heimwärts. Tauchzeit 46
Minuten. Maximale Tiefe sieben Meter. In jedem
Trockentauchanzugbein schwappt ein Liter Mittelmeer.
Am Abend wird es
empfindlich kühl. Ich ziehe mich in das Wohnabteil des
Wagens zurück, also auf den Rücksitz. Dazu: Notizbuch, Grog
mit Rum aus Rostock und eine um Hüften und Beine
geschlungene Decke. Nachdenklich blase ich in die dampfende
Tasse. Hatte ich im Unterbewusstsein - beeinflusst von
Bildberichten mit wunderschönen Drucken - die Farbpalette
und Artenvielfalt tropischer Meere erwartet?
(Aus:
Nur tauchen, reisen,
schreiben, Teil I und
Tauchen auf Korsika)
nach unten
nach
oben
home
Inhaltsverzeichnis
Mein erster Tauchgang in der
Karibik: 1980, Dominica, Antillen
Wenn Fortuna,
die Glücksgöttin, ihr Füllhorn schüttelt, ergießt sich
bekanntlich ihr Segen in recht unterschiedlicher Quantität
auf uns Irdische. Ich aber kann nicht klagen. Und gewiss
hatte Fortuna auch bei dem folgenden Ereignis die Hand mit
im Spiel: Bereits 36 Stunden nach meinem Abflug aus dem
kalten Europa, am Donnerstag, den 13. November 1980, so
gegen 11 Uhr, tauche ich erstmals mein Gesicht in die 2,75
Mio. km² Karibik.
 Schwimmflossen,
Maske und Schnorchel übergestreift und hinein ins Wasser.
Seit 25 Jahren bin ich es gewohnt, beim Durchbrechen der
Wasseroberfläche in eine Art grünlichen Nebel zu schauen.
Unsere Binnenseen erlauben allenfalls Sichtweiten von
wenigen Metern. Grün schimmerndes Wasser, grüne Pflanzen und
Herbstfarben dominieren. Und nun dies: Helligkeit, bunte
Farben, seltsame Formen, Weite. Die Sicht liegt bei 15 bis
20 Meter. Es ist, als ob man eine Tür aufreißt und anstelle
in das gewohnte, ein wenig melancholische Zimmer plötzlich
in einen kristallfunkelnden Saal blickt mit einem
rauschenden Maskenball. Und mein Blickfeld weitet sich zu
einer großen Wunderwelt. Schwimmflossen,
Maske und Schnorchel übergestreift und hinein ins Wasser.
Seit 25 Jahren bin ich es gewohnt, beim Durchbrechen der
Wasseroberfläche in eine Art grünlichen Nebel zu schauen.
Unsere Binnenseen erlauben allenfalls Sichtweiten von
wenigen Metern. Grün schimmerndes Wasser, grüne Pflanzen und
Herbstfarben dominieren. Und nun dies: Helligkeit, bunte
Farben, seltsame Formen, Weite. Die Sicht liegt bei 15 bis
20 Meter. Es ist, als ob man eine Tür aufreißt und anstelle
in das gewohnte, ein wenig melancholische Zimmer plötzlich
in einen kristallfunkelnden Saal blickt mit einem
rauschenden Maskenball. Und mein Blickfeld weitet sich zu
einer großen Wunderwelt.
Ich treibe
staunend an der Oberfläche. Heller Sand bedeckt in Ufernähe
den rasch abfallenden Grund. Hier und da stehen kleine
Korallenstöcke, um die sich bunte Fische tummeln. Schwämme
und viele langstachelige Seeigel sind - neben den Fischen -
die auffälligsten Bewohner. Weiter draußen reißt die
Bodenlinie jäh ab. Dahinter schimmert nur noch tiefblaues
Wasser.
Ich knicke
vornüber und strecke sekundenlang die Flossen in die Luft.
Deren nun nicht mehr vom Auftrieb kompensierte Masse drückt
mich ohne großes Geplätscher unter die Oberfläche. Ein
Armzug vollendet den Abtauchvorgang. Ich gleite hinab, muss
aber sogleich tüchtig mit den Flossen nachhelfen. Durch den
hohen Salzgehalt besitzt das Seewasser einen ungewohnt
starken Auftrieb.
Mich umfängt -
nein, keine Stille! Ein gut hörbares Knistern, Rauschen,
Knacken, Schurren und Prasseln erfüllt die ufernahe Zone:
die Töne des Wellenschlags, das Mahlen von Geröll und
Schaltierresten in den Brandungswirbeln und all die Laute
der Tierwelt wie Verständigungssignale und Fressgeräusche.
In etwa 4 Meter Tiefe ist vor allem durch Kompression des
Brustkorbes meine Verdrängung genügend geschrumpft: Ich
schwebe auf einen Korallenstock zu, mit ausgebreiteten Armen
und Beinen steuernd, ähnlich einem Fallschirmspringer. Ich
lande in etwa 6 Meter Tiefe im Sand neben einem
Korallenstock. Das prächtige meterhohe Gebilde besteht aus
mindestens drei verschiedenen Korallenarten und ist
dichtbewohnt. Fische schießen durch das Geäst. Röhrenwürmer
schwingen ihr feinen Tentakel. Ein Seeigel sucht nach
Nahrung. Alles ist fremdartig und von verwirrender Vielfalt.
Ich staune, bis mir der Atem ausgeht.
Einige rasche tiefe Atemzüge
stabilisieren
zwar den Gasstoffwechsel, aber nicht den emporgeschnellten
Puls. Der hat psychische Ursachen. Bloß wieder hinab.
Abermals tauche ich in den Ballsaal mit seinem
geheimnisvollen Gezischel. 3 - 5 - 8 Meter. Man merkt gar
nicht, wie flott es in die Tiefe geht. In unseren Binnenseen
wäre es nun bereits unheimlich: dunkel, kalt und der Grund
trostlos kahl. Jetzt sehe ich deutlich die Abbruchkante des
Meeresgrundes. Steil scheint der Boden ins Unermessliche
abzufallen. Das rechte Ohr schmerzt. Schwierigkeiten mit dem
Druckausgleich. Ich steige höher, bis das Stechen im Ohr
abklingt und schwimme zu einem anderen Block. Wie diese Welt
nur beschreiben? So die Klage wohl aller Neulinge in
tropischen Unterwasserlandschaften.
Einsetzender
Lufthunger mahnt zur Rückkehr. Widerstrebend verlasse ich
den Korallenstock. Noch besitzt er für mich die Ausstrahlung
jener abstrakten Malerei, die als „schön" empfunden wird,
ohne dass sich dieser Eindruck mit nachprüfbaren Fakten
belegen ließe. Auch biologische Details vermag ich noch
nicht zu unterscheiden, allenfalls grobe Einteilungen wie
Weichkorallen, Schwämme, Röhrenwürmer, Seeigel und Fische.
An der
Oberfläche noch nach Luft japsend, kann ich es kaum
erwarten, wieder im Meer zu versinken. Dabei ist die
Szenerie eher karg im Vergleich zu jenen Landschaften, die
auf dieser Reise noch zu durchmessen sind. Die Larven der
Korallenpolypen und Schwämme benötigen nämlich zur
Ansiedlung festen Untergrund. In der seichten sandigen Bucht
aber bieten sich wenige Kolonisationsmöglichkeiten, zumal
Stürme aufkeimendes Leben leicht wieder verschütten. Deshalb
stehen lediglich knie- bis gut mannshohe Korallenformationen
vereinzelt herum wie Büsche in der Wüste. Freilich genügt
Tropic-Greenhörner bereits gute Sicht, Wasser von etwa 26 °C
und eine bescheidene, aber noch nie geschaute Fauna, um in
Freudenstürme auszubrechen. Bereits wenige Jahre später
würde ich mich nur vage an das Geschaute erinnern - zu viele
andere reizvollere Bilder überfluteten die ersten Eindrücke.
Unvergessen aber bleibt das Gefühl tief empfundenen Glücks.
Nach einer
dreiviertel Stunde treibt mich einsetzendes Frösteln zurück
an das Ufer. Ich trenne mich mit dem Wissen, dass von nun an
die Zeit nicht schnell genug vergehen werde, bis ich mit dem
Tauchgerät und der Unterwasserkamera in diese Welt
zurückkehren kann.
(Aus:
Nur
tauchen, reisen, schreiben, Teil I)
|