|
Von Quallen, Schnecken und Krebsen -
Berichte aus unserer Unterwasserwelt
Ach, arme Qualle -
Gepanzerte Ritter: Flusskrebse - Schnecken, Schnecken, Schnecken -
Vom Fressen und Gefressen werden
|
nach unten
Klicken auf Bilder mit Hyperlinks erlaubt eine größere Darstellung,
retour via Browserbutton "zurück"
Quallen – ein Plädoyer
 Wenn auch Star mancher Unterwasserfotografen, so sind sie doch im Grunde genommen bedauernswerte Tiere. Zeit ihres Lebens in der Medusenform, müssen sie unermüdlich schwimmen: nur die ständige Eigenbewegung bewahrt sie vor dem Absinken, vor der Bodenberührung. Wie bei vielen planktischen Tieren, bedeutet das auch für die Quallen den Anfang vom Ende. Vor dem Ufer müssen sie sich ebenso hüten: Nur zu leicht packen die Brandungswellen zu und spülen die hilflosen Tiere an den Strand; als hässliche gallertartige Klumpen bleiben sie da liegen. Aus! Und wir? Bei den meisten Urlaubern sind sie verrufen: Ih, glibberige Quallen! Die vergällen einem ja die Badefreuden. Auch bei den Fischern sind sie unbeliebt: Die mitunter recht großen Quallenschwärme verstopfen ihnen die Netze. Einmal wurden gar Ohrenquallen so dicht zusammengetrieben, dass ein in sie gestecktes Ruder stehen blieb. Und überhaupt: Quallen sind doch nur unschöne, formlose, gallertartige Klumpen! Das einzig Interessante an ihnen ist vielleicht der Effekt, der sich am Strand mit einer Handvoll Quallen gegenüber Mädchen erzielen lässt. Man weiß schon . . . Wenn auch Star mancher Unterwasserfotografen, so sind sie doch im Grunde genommen bedauernswerte Tiere. Zeit ihres Lebens in der Medusenform, müssen sie unermüdlich schwimmen: nur die ständige Eigenbewegung bewahrt sie vor dem Absinken, vor der Bodenberührung. Wie bei vielen planktischen Tieren, bedeutet das auch für die Quallen den Anfang vom Ende. Vor dem Ufer müssen sie sich ebenso hüten: Nur zu leicht packen die Brandungswellen zu und spülen die hilflosen Tiere an den Strand; als hässliche gallertartige Klumpen bleiben sie da liegen. Aus! Und wir? Bei den meisten Urlaubern sind sie verrufen: Ih, glibberige Quallen! Die vergällen einem ja die Badefreuden. Auch bei den Fischern sind sie unbeliebt: Die mitunter recht großen Quallenschwärme verstopfen ihnen die Netze. Einmal wurden gar Ohrenquallen so dicht zusammengetrieben, dass ein in sie gestecktes Ruder stehen blieb. Und überhaupt: Quallen sind doch nur unschöne, formlose, gallertartige Klumpen! Das einzig Interessante an ihnen ist vielleicht der Effekt, der sich am Strand mit einer Handvoll Quallen gegenüber Mädchen erzielen lässt. Man weiß schon . . .
Aber – diese Frage gilt den Nichttauchern – hat man diese Lebewesen schon einmal in ihrem natürlichen Element beobachtet? Fair play; man bedenke den umgekehrten Fall. Wo bleibt denn – all der Hilfsmittel wie Maske, Flossen und Tauchergeräte beraubt – unsere Überlegenheit unter Wasser? Doch bereits ein einziger Sommertag an der See bietet Gelegenheit zur Revision. Man leihe sich nur eine Tauchermaske und einen Schnorchel. Die Quallen, Ohrenquallen, findet man bereits im seichteren Wasser fast überall an der Ostseeküste. Keine Sorge, ihr Nesselgift dringt nicht durch die Haut. Anders wäre es bei den Gelben Haarquallen, die gelegentlich aus dem Kattegat bis vor unsere Küste getrieben werden. Sie nesseln sehr stark. Doch die Ohrenquallen, kenntlich an den „Ohren“, den vier durchscheinenden hufeisenförmigen Keimdrüsen, kann man unbesorgt betrachten. Also auch die Furcht der Baselustigen vor „brennenden“ Kontakten ist völlig unbegründet.
Der erste Blick durch die Tauchermaske: Traumhaft leicht schweben die Tiere im Wasser, rhythmisch verändern sei ihre Form. Sie kontrahieren zu einem riesigen Tropfen. Das so aus der Schirmhöhle gepresste Wasser verleiht ihnen ein Vorschub. Dann entfalten sie sich wieder fallschirmartig. Wer könnte diese transparenten zarten Lebewesen, ihr gemessenes, graziles Pulsieren, das harmonische Schwingen der feinen Randtentakel noch hässlich nennen? Und uninteressant? Vielleicht dies aus dem Leben der Quallen:
Die jungen Scyphozoen (Schirmquallen), zu dieser Klasse gehören auch die Ohren- und Haarquallen, kommen im Generationswechsel auf die Welt. Generationswechsel ist ein „meist regelmäßiger Wechsel zwischen einer sich geschlechtlich fortpflanzenden Generation und einer oder mehreren sich ungeschlechtlich vermehrenden Generation“. Das bedeutet: Aus den in den Keimdrüsen der getrenntgeschlechtlich Scyphozoen gebildeten Ei- und Samenzellen wachsen winzige freischwimmende Planula-Larven heran. Bei den Ohrenquallen entwickeln sich die Embryonen in den Falten der Mundarme (Brutpflege!). Nach kurzer Schwärmzeit sinken die Larven auf den Grund. Sie bilden sich zu einigen Millimetern großen Polypen um. In jedem Frühjahr entsteht dann aus den Polypen eine neue Generation von Medusen. Bei der Ohrenqualle sogar zweimal im Jahr. In der nun folgenden ungeschlechtlichen Phase ähnelt der Polyp einem Stapel winziger ineinander gestellter Teller. Nach und nach schnüren sich von den Polypen winzige Scheibchen ab, die Ephyren. Die Ephyren der Ohrenqualle messen etwa vier Millimeter im Durchmesser. Sie schwimmen durch ein zusammenschlagen der Randlappen. Nach dem Ablösen aller Scheiben bilden sich neue Tentakel aus. Bald hat der Polyp wieder seine Normalgestalt. Aus den Ephyren aber entwickelt sich innerhalb von Wochen die bekannte Medusenform. Sie wächst heran, wird geschlechtsreif – und der Kreislauf beginnt von neuen.
Die Ohrenquallen fressen Krebstiere, vielerlei Larven und kleine Fische, die sie mit kräftigen Mundarmen festhalten und durch ihr Nesselgift lähmen. Deshalb spricht man auch von Nesseltieren. Mikroorganismen werden dagegen von den Wimpern der Schirmunterseite gefangen und zu Gruben am Schirmrand befördert. Hat sich genügend Nahrung angesammelt, langen die Tiere mit den Mundarmen da hinein, nehmen die Nahrungsklümpchen auf und strudeln sie der Mundöffnung zu.
Hässlich? Uninteressant? Man möge
erwägen: Hat nicht vielleicht der eine oder andere Standwanderer,
Badegast oder Taucher den Quallen etwas abzubitten?
nach unten
nach oben
home
Schnecken, Schnecken, Schnecken
Sicher schon so lange, wie der Mensch sich auszudrücken vermag, spricht man verschiedenen Tieren menschliche Eigenschaften zu: Füchse sind schlau, Schakale feige, Elstern diebisch, Ochsen dumm und so weiter. Von sich auf andere zu schließen, ist ja eine der typischen menschlichen Schwächen. Damit aber nicht genug. Bei Bedarf wird der Spieß mit den etikettierten Tieren umgekehrt. Man sagt, jener sei gutmütig wie ein Schaf, ein anderer störrisch wie ein Esel, ein dritter tapfer wie ein Löwe! Aber ist das Faultier wirklich in unserem Sinne faul und die Biene ein echtes fleißiges Lieschen, etwa vergleichbar jenem bewundernswerten Wesen, das einen Haushalt mit fünf Kindern in Schuss hält und überdies noch ganztags arbeitet?
Im Gegensatz dazu stehen physische Vergleiche, Abschätzungen etwa mit physikalisch und biochemisch erfassbaren Kennwerten. Man misst dabei mit einer Elle, deren Maß wir wohl selten erreichen. Wir sind weder flink wie Wiesel, noch scharfäugig wie Adler, kaum aufmerksam wie Luchse, aber auch nicht so langsam wie Schnecken. Denn dies ist die wohl bekannteste Eigenschaft jener Weichtiere: sehr, sehr langsam. Sie sind es in der Tat. Und doch ist auch dieses Urteil wieder paradox. Wären die Schnecken noch langsamer, bewegten sie sich fast überhaupt nicht von der Stelle, nähme man das als selbstverständlich. Ein ansässiges Tier. Wer schimpft schon: Du lahme Muschel? Im Grunde genommen ist also die Schnecke noch viel zu schnell! Nur deshalb entgeht sie nicht unserem abschätzigen Urteil. Man hüte sich also vor allzu menschlichen Maßstäben.
Wie auch immer, menschlich sind jedenfalls die Versuche, die Tiere und Pflanzen in ein System einzugliedern, das Zusammenhänge zwischen den Organismen erkennen lässt. Genauer gesagt: Zusammenhänge in der stammesgeschichtlichen Entwicklung, verwandtschaftliche Beziehungen. Innerhalb eines solchen natürlichen Systems der Tiere gehören die Schnecken zu den Weichtieren (Mollusca). Die typischsten Vertreter dieses Stammes sind die Klassen Schnecken, Muscheln und Kopffüßer (Tintenfische).
Etwa 105 000 verschiedene Schneckenarten (Gastropoden) sind heute bekannt. Sie besiedeln fast alle Lebensräume. Man findet sie auf dem Land wie im Wasser, an den Küstensäumen wie in,der Tiefsee. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit, ,der Möglichkeit, die Unbill ungünstiger Perioden zurückgezogen im Gehäuse zu verbringen und mit einer mit Zähnchen bewehrten Zunge sich aus den unmöglichsten Objekten fressbares herausraspeln zu können, vermochten sie selbst da noch zu existieren, wo andere gleich hoch entwickelte Lebewesen passen mussten.
Etwa 350 Arten zählen zu den einheimischen Schnecken. Berücksichtigt man nur die in den Binnenseen lebenden Tiere, so reduziert sich deren Vielfalt noch einmal beträchtlich. Es bleibt - geschätzt nach der Durchsicht einschlägiger Literatur und eigenen Beobachtungen - ein rundes Dutzend Arten, mit deren Kenntnis man die meisten unter Wasser anzutreffenden Vertreter der Bauchfüßer sicher anzusprechen vermag. Natürlich sind das in der Regel die großen Exemplare, die einem zuerst ins Taucherauge fallen. Doch zunächst etwas über den Körperbau und zur Biologie dieser Tiere.
Der Körper besteht aus dem Kopfteil mit „Fühlhörnern", Augen und einer Mundöffnung und dem gestreckten Rumpf mit einem platten Kriechfuß. Auf dem Rücken befindet sich der von einem Mantel überzogene, spiralig gewundene Eingeweidesack. Der Mantel produziert das wohl typischste Merkmal des meisten Schnecken, eine aus mehreren Schichten bestehende Kalkschale, das „Schneckenhaus“. Schnecken atmen über Kiemen (Kiemenschnecken), Gefäßnetze in der Mantelhöhle (Lungenschnecken) und durch die Haut. Sie nehmen überwiegend pflanzliche Nahrung auf. Die Vorderkiemer unter den Schnecken sind meist getrennt geschlechtlich, die Hinterkiemer und Lungenschnecken zwitterig. Vorderkiemer bedeutet übrigens, dass die Kiemen vor dem Herzen liegen. Fast alle Schnecken legen Eier.
Einer der interessantesten biologischen Vorgänge ist die Bewegung der Schnecke. Wenn sie sich in ihrem Haus befindet, hat sie nicht etwa Ruhe; sie muß „hart arbeiten“; das Muskelsystem des Fußes in angespanntem Zustand halten. Lässt der Muskeltonus nach, saugt sich das kapillare Schwellgewebe des Fußes sofort voll Blut, findet in dem Gehäuse keinen Platz mehr und rutscht heraus. Dieser Schwellzustand reicht aber nicht zum Kriechen. Die Schnecke presst deshalb zusätzlich Blut bis in die feinsten Kapillaren, so dass der Fuß prall und kriechfähig wird.
Beobachtet man eine Schnecke bei der Fortbewegung, so fällt auf, dass nirgends Bewegungen zu sehen sind und das Tier dennoch vom Fleck kommt. Setzt man das Tier auf eine Glasplatte und betrachtet es von unten, so sieht die Sache anders aus. Man kann wellenförmige Bewegungen beobachten, die über die Sohle des Fußes nach vorn gleiten und die jedes Fußteilchen immer ein Stück voranbringen. Apropos beobachten, hat man sich schon einmal Gedanken gemacht, wie sich eine „auf dem Rücken“ liegende Schnecke umdreht? So simple Dinge lassen sich in der Natur entdecken. Einfach eine Schnecke im seichten Wasser aufs „Kreuz“ legen. Das Ergebnis der nun folgenden Bemühungen zeigen die Abbildungen.
Auch die Aufzeichnung solcher Vorgänge ist sicher eine interessante Aufgabe für Unterwasserfotografen. Die Schnecke geht nun nicht einfach nur so zu Fuß. Sie schreitet auf einem selbst ausgelegten Teppich, einem Schleimband, mit dessen Hilfe sie sich gut am Untergrund festzuheften vermag und das die Reibungswiderstände mindert. Der Schleim wird von einer großen Drüse erzeugt und durch eine schlitzförmige Mündung unterhalb der Mundöffnung ausgeschieden. Kehrt die Schnecke in ihr Haus zurück, wird durch Muskelkontraktion das Blut aus dem Schwellgewebe des Fußes gepresst, der Fuß meist in der Länge zusammengefaltet und der Schneckenkörper durch einen Rückziehmuskel ins Gehäuse gezogen. Zum Schluss kommt, wenn vorhanden, der Deckel vor die Mündung.
Durch die drei bräunlichen Bänder und den Deckel gehören die maximal 30 bis 40 Millimeter großen Sumpfdeckelschnecken zu den bekanntesten Schneckenarten unserer Gewässer. Sicherstes Unterscheidungsmerkmal beider Arten ist die Gehäusespitze: Bei unbeschädigter Ausbildung ist sie bei der Viviparus contectus scharf und stechend, bei der
Viviparus viviparus abgestumpft. Die Sumpfdeckelschnecken sind „lebendgebärend“, da sie die Jungen bis zum Schlüpfen aus den Eiern in einer Erweiterung des Eileiters aufbewahren. Die erste Art bevorzugt ruhiges, die andere mäßig bewegtes Wasser.
Die Plötzenschnecke ist überall sehr häufig und eine beliebte Nahrung der Fische. Das bis zu sieben Millimeter breite oder hohe Gehäuse ist in Abhängigkeit vom Siedlungsraum recht unterschiedlich ausgebildet. Es ähnelt in der Form oft mehr einer kleinen Sumpfdeckelschnecke. Diese Tiere haben eine fein gefiederte hervorstreckbare Kieme. Man kann sie bei herumkriechenden Tieren beobachten, muss aber schon sehr genau hinsehen. Schnorchelt man am Schilfsaum entlang, so fallen einem des öfteren die recht gern auf Rohrhalmen siedelnden stattlichen Schlammschnecken auf. Sie haben breite dreieckige Fühlhörner und können in der warmen Jahreszeit an der Wasseroberfläche Luft atmen. Ihre Gehäuseform variiert öfter in Abhängigkeit vom Siedlungsraum.
Die Große Schlammschnecke und die Sumpfschlammschnecke haben gestreckte spitze Gehäuse (60 bzw. 40 Millimeter hoch). Die Gehäuseoberfläche der Sumpfschlammschnecke hat meist eine streifige rippenähnliche Struktur. Die bis 30 Millimeter breite und hohe Sumpfschlammschnecke hat ein Gehäuse aus vier Windungen. Die ersten drei bilden ein kleines spitzes Gewinde, während die letztere sehr groß und aufgeblasen ist und einen stark erweiterten Mundsaum hat.
Unverwechselbar sind auch die Tellerschnecken durch die besondere Form des Gehäuses, das in einer Ebene aufgerollt ist. Die bis zu 33 Millimeter breite Posthornschecke ist die größte einheimische Spezies dieser Gattung. Ihre Umgänge sind rund. Im Gegensatz dazu haben die Umgänge der nächstkleineren Vertreter eine Art Kiel; bei der bis u 15 Millimeter breiten Gekielten Tellerschnecke steht er in der Mitte, bei der bis zu 17 Millimeter breiten Gerandeten Tellerschnecke am Rand. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe winziger Tellerschneckenarten, die überwiegend die Krautbestände besiedeln.
In fast allen Gewässern beheimatet ist die Flussnapfschnecke. Ihre Schale ähnelt einer Art flachen Zipfelmütze mit nach hinten geneigter Spitze. Da sie nur bis 7,3 Millimeter lang ist, wird sie leicht übersehen.
Die letzte der hier genannten häufigeren oder auffälligen Arten ist die Blasenschnecke (Physa fontinalis). Ihre bis zu 10,5 Millimeter hohe Schale hat drei sehr kleine und einen großen eiförmigen Umgang. Die Schnecke kriecht relativ schnell und besitzt einen eigenartigen Abwehrreflex: Berührt man die beiden über die Schale zurückgeschlagenen Mantelklappen oder deren fingerartige Fortsätze, so wirft sie ihr Gehäuse schnell von einer auf die andere Seite. Vermutlich hofft sie, so den vermeintlichen Gegner abzuschütteln.
Für eine Groborientierung unter den heimischen Schnecken mag dies genügen. Sicher gibt es in Abhängigkeit von den von uns besuchten Gewässern noch die eine oder andere häufige Art. Da helfen dann Bestimmungsbücher. Und noch eines für den, der sich eine Sammlung von Gehäusen der einheimischen Muscheln und Schnecken anzulegen beabsichtigt: Man muss nicht unbedingt 1ebenden Exemplaren den Garaus bereiten; das Sammeln leerer Gehäuse ist viel fairer - der Natur gegenüber!
nach unten
nach oben
home
Gepanzerte Ritter: Flusskrebse
Über mangelnde Popularität können sie sich wirklich nicht beklagen! Es gibt nur wenige natürliche Gewässer, in denen keiner der langschwänzigen Krebse wohnt. Wenigstens heute noch.
Schuld an der Tatsache, dass man Flusskrebsen noch so häufig begegnet, ist ein gewisser Herr von dem Borne, ein in Fachkreisen allseits bekannter Fischzüchter. 1890 nun ließ er einhundert aus Pennsylvanien importierte Amerikanische Flusskrebse (Orconectes limosus) in Teichen bei Berneuchen frei, auf dass sie wuchsen und sich mehrten. Das taten sie denn auch, und zwar so gründlich, dass sie sich fast über ganz Mitteleuropa ausbreiteten. Nach Literaturangaben sind die einhundert Krebse die Ahnen aller heutigen mitteleuropäischen Orconectiden. Die anderen bei uns anzutreffenden Flusskrebse, der Edelkrebs (Astacus astacus) und der Galizische Sumpfkrebs (astacus leptodactylus ESCHHOLZ) sind dagegen einheimische Arten. Aber die Krebspest hat unter ihnen verheerend gewütet. Die zunehmende Begradigung der Wasserläufe und die Umweltverschmutzung bewirkten ein übriges. Heute findet man nur noch vereinzelt Bestände der einst so häufigen einheimischen Tiere. Lediglich die Burschen aus Übersee erwiesen sich nicht nur als gegen die Krebspest immun, sondern vermochten durch ihre Anpassungsfähigkeit und Robustheit noch manch anderer Unbill der Zeiten zu trotzen.
Die Dämmerung bricht herein. Die Flusskrebse und ihre Interessenten werden munter. Die in der Uferzone lebenden und nachts aktiven Tiere kriechen aus ihren Verstecken und stöbern nach Nahrung. Pflanzenteile, Muscheln, Schnecken, Insektenlarven - alles was ihnen vor die Kieferfüße kommt, wird ergriffen, eventuell zerkleinert und in den Mund gestopft. Das mangelnde Witterungsvermögen und die Behäbigkeit erlaubt es ihnen nicht, besonders wählerisch zu sein.
Umgekehrt halten sich auch die „Interessenten" an den Krebsen schadlos. Vor alle Bisamratten, Barsche, Aale und Quappen schätzen die Krustentiere. Dann gibt es da auch noch die beiden Arten der Zweibeiner. Die einen waten mit Taschenlampen und Eimerchen die Uferstrecken ab und denken wieder an ein neues Rezept. Die anderen schwimmen mit Tauchermaske, Schnorchel und Lampe im seichten klaren Gewässer, um dem nächtlichen Treiben der Fauna, also auch dem der Krebse, nachzuspüren.
Die letztere Spezies ist harmlos. Ihr Reiz ist optischer Natur, das Vergnügen intellektueller Art. Wohl haben sie nicht die Qual der Wahl, ob dem Kochwasser Petersilie oder lieber Dill beizufügen sei. Doch haben sie andere Freuden, möglicherweise die des Erkennens. Sie unterscheiden die Arten: die Amerikaner tragen deutliche rostbraune Querbinden auf dem Hinterleib. Die Galizier sind wesentlich schlanker als die Edelkrebse (die Männchen haben besonders lange dünne Scheren), ihre Rückenseite ist gefleckt oder marmoriert. Die Edelkrebse haben massige Scheren, einfarbige Rückenseite und sind an den Augenstielen, den Beingelenken und auf der Bauchseite deutlich rot gefärbt. Die Geschlechter halten sich an das Mann-Weib-Schema. Die Herren haben breitere „Schultern“ und schmalere „Hüften“ (sprich: Rumpf und Hinterleib). Bei den Damen ist es umgekehrt.
Vielleicht wissen auch die schnorchelnden Zweibeiner um die schwersten Stunden im Leben der Flusskrebse, um das Häuten. Krebse haben bekanntlich ein aus Kalk und Chitin bestehendes starres „Außenskelett“. Nach einiger Zeit wird es ihnen zu eng. Die Tiere kriechen in Schlupfwinkel. Das Panzermaterial beginnt sich größtenteils aufzulösen. Durch Muskelkontraktionen und Bewegungen wird die Hülle gelockert. Schließlich platzt sie zwischen Rumpf und Hinterleib. Die Krebse ziehen Kopf und Vorderkörper, dann Füße und endlich den Hinterleib heraus. Die nun ungeschützten weichen „Butterkrebse“ verbringen die nächsten Tage im Versteck. Die Muskulatur dehnt sich und wächst. Doch in acht bis zehn Tagen hat Waffenmeister Natur durch Kalkeinlagerungen aus dem Wasser den neuen Panzer fertig und die Krebse nehmen wieder den alten Lebenswandel auf. Nur hier und da herumliegende Hüllen erinnern an diese Vorgänge. Dabei häuten sich die Amerikanischen Flusskrebse normalerweise dreimal im Jahr: im Juni, im Juli/August und im September.
Die ganz großen Banausen unter den Mit-dem-Eimerchen-Water wissen nicht einmal, dass der Krebs nicht rückwärts geht, sondern nur auf der Flucht rückwärts schwimmt. Doch man kann hoffen, auch künftig zumindest Amerikanische Flusskrebse in unseren Gewässern beobachten zu können. Denn so schnell - glücklicherweise - lassen sie sich nicht ausrotten. Die nicht, oder wenigstens: noch nicht. Edelkrebse und Galizier aber bedürfen als ein Teil dahinschwindender heimatlicher Natur unserer Nachsicht oder gar Hilfe.
nach unten
nach oben
zurück zur Hauptseite
nach oben | home |
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Für
Nachfragen per E-Mail
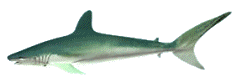
|


