Wege in die Tiefe
Klicken auf Bilder mit
Hyperlinks erlaubt eine größere Darstellung, retour via
Browserbutton "zurück"
 Aus der Geschichte des Tauchens - Zeittafeln, Episoden und Literaturhinweise.
248 Seiten DIN A4, 178 Abbildungen, allein 62 Seiten Bibliografie. Softcover mit
farbigem Einband. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage / Edition 2013, ISBN
978-3-937522-27-2, gebundener Ladenpreis € 19,80. Aus der Geschichte des Tauchens - Zeittafeln, Episoden und Literaturhinweise.
248 Seiten DIN A4, 178 Abbildungen, allein 62 Seiten Bibliografie. Softcover mit
farbigem Einband. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage / Edition 2013, ISBN
978-3-937522-27-2, gebundener Ladenpreis € 19,80.
Die umfangreichste je in Deutschland publizierte Zeittafel zur Geschichte des Tauchens und ihrer Randgebiete! Außerdem eine der umfassendsten alphabetisch geordneten Sammlungen
bibliografischer Quellennachweise zur Geschichte des Tauchens. Und
um die trockene Datensammlung etwas mit Leben zu erfüllen: ein
Dutzend erzählende Episoden.
Bestellung per E-Mail Ihre
Anschrift bitte nicht vergessen! Ihre
Anschrift bitte nicht vergessen!
nach
unten
Leseproben:
1863: Wilhelm
Bauers Bergung der
Ludwig
-
1864 und später: Vormarsch der Tauchfahrzeuge
Inhaltsverzeichnis
Über den Beginn / Perlentaucher, das
älteste Tauchergewerbe / Die Geschichte als Zeittafel von v. Chr.
bis 1849 / Um 1500 und später - Leonardo in Venedig / Um 1592 und
später - Die Ideen des Kriegsingenieurs Buonaiuto Lorini / Um 1620
und später - Sir Francis Bacons „Große Erneuerung der
Wissenschaften“ / Um 1670 und später - Giovanni Alfonso Borelli und
seine „Vorrichtung, welche dem Menschen stundenlanges Taucher
ermöglicht“ / Um 1690 und später - Tauchende Nachen aus Holz / Die
Geschichte als Zeittafel von 1850 bis 1934 / Um 1785 und später -
Jürgen C. Weiss, der erste deutsche Tauchpionier / Um 1777 und
später - Die Tauchmaschine des Karl Heinrich Klingert / Um 1800 und
später - Robert Fulton, Vater der Nautilus / Um 1811 und später -
Johann Driebergs nickender und pfeifender Taucher / Um 1863 und
später -
Wilhelm Bauers Bergung der Ludwig
/ Die Geschichte als Zeittafel von 1935 bis 2000 / Um 1878 und
später - Die ersten Tauchmediziner - P. Bert und J. S. Haldane / Ab
1901 und später - Die neue Zeit / Um 1946 und später -
Vormarsch
der Tauchfahrzeuge / Um 1928 und später - Fahrstühle zum
Meeresgrund / Um 1957 und später - Vorstoß ins Unmögliche / Um 1961
und später - Schwarzes Gold aus grünem Wasser / Um 1966 und später -
Unbemannte Arbeitssysteme erobern die UW-Welt / Alphabetisches
Quellen- und Literaturverzeichnis / Namensregister / Über den Verlag
Norbert Gierschner
1863: Wilhelm Bauers Bergung der Ludwig
Der Wind fuhr landeinwärts und trieb Wellen gegen die jütländische Küste. Nahe am Strand stand eine reglose Gestalt, gehüllt in einen Uniformmantel der schleswig-holsteinischen Artillerie. Der Wind zerrte an seinen Haaren. Fröstelnd schlug der Mann den Kragen hoch, ohne den Blick von einem länglichen Etwas zu lassen, das da an der Scheide zwischen Land und Wasser verharrte.
Noch vor Minuten hatte der Mann an die dänischen Kriegsschiffe gedacht, die ungehindert die Küstengebiete beschießen konnten. Man müsste irgend ein Fahrzeug haben, hatte er gegrübelt, das unter dem Meeresspiegel fährt. Unsichtbar für den Gegner und es müsse einem vor dem Wasserdruck schützen. Mit einer Mine müsste man den Gegner versenken können.
nach oben
Diese Vorstellungen hatten ihn nicht verlassen, hatten nach Gestalt gerungen. Er suchte eine Form, irgend eine Form. Auch hier, auch jetzt. Da, schon zum Gehen gewandt, war sein Blick auf dieses klumpige Etwas gefallen. Wieder bewegte es sich, hob den stumpfen kegelförmigen Kopf. Plötzlich verschwand es mit einigen Sätzen im schäumenden Wasser. Das Etwas war ein Seehund. Dem Manne aber war es, als werde es taghell. Er hatte sein Heureka!
Gleich diesem Bild, wenn auch mit anderen Sätzen, beginnen fast alle Erzählungen um Wilhelm Bauer. Sicher nicht ganz zu Unrecht, denn eine solche Beobachtung könnte sein Leben entscheidend verändert haben. Aus unklaren Vorstellungen, Tagträumen und vagen Überlegungen, aus der Suche nach Neuem, hatte sich so viel Gedankengut in ihm angehäuft, dass es nur noch eines winzigen Anstoßes bedurfte. Wie etwa ein kleines Steinchen leicht ein Schneefeld in eine mächtige Lawine zu verwandeln vermag. Diese Lawine war seine Idee.
Nichts ist quälender als so eine Idee. Sie verleiht den Tagen Unrast und nimmt den Nächten die Ruh. Alles kreist nur noch um diese Idee, alles tritt hinter ihr zurück. Glücklich darf der sein, dessen Idee mit den Forderungen seiner Umwelt in harmonischer Kontinuität verläuft; bedauernswert aber der, wo sie um Jahre voraus ist. Bauer gehörte zu den letzteren. Genie ja, aber ohne Erfolg. Seine Idee - der „Eiserne Seehund“.
Es war ein langer schwerer Weg, den der Korporal der Artillerie, Wilhelm Bauer, nun zurückzulegen hatte. Gering war seine Vorbildung. Die kleine Volksschule in seinem Geburtsort Dillingen an der Donau; später in Speyer und München ein bisschen Latein, Physik und Mathematik, eine königliche Stiftung, eine Drechslerlehre. Bauer begann ganz von vorn und ganz für sich. Wie Kolumbus griff er zum Ei, zu einem ganz gewöhnlichen Hühnerei. Das und eine Schüssel Wasser genügten ihm vorerst, um seine schon auf zwei Jahrtausende bekannten Gesetzmäßigkeiten basierende Idee zu beweisen. Doch später reichte ihm das nicht mehr. Fachbücher, wissenschaftliche Werke mussten her, um durch Theorie das Experiment zu unterstützen. Modelle wurden gebaut.
Die Jahre vergingen. Sie verwandelten den Autodidakten, den Kanonier in einen kaiserlichen Submarine-Ingenieur der russischen Marine. Freilich nicht verbrieft, kein ordentlich Studierter, worauf auch seine Gegner immer hinwiesen. Halt ein närrischer Dilettant! Sagten sie. Aber sprachen nicht seine Leistungen für ihn? Was hatte Bauer nicht alles ersonnen, konstruiert. Seine Pläne reichten von einfachem Kanonenhebezeug über schwimmende Revolverbatterien, Bergungsverfahren, Tauchbooten, Eiskanalschneidern, Rettungsbooten, Tauchkammern bis hin zu einem unter Wasser zu stationierenden Kabelleger.
nach oben
Immer wieder war es das Wasser, jene Region unterhalb des Meeresspiegels, die gewöhnlich den Menschen verborgen blieb, die ihn magisch anzog. Bauer wusste Gründe zu nennen: „Die Natur hat uns keine Tiere in die Meere gegeben, welche, ähnlich wie unsere Schiffe, gehalten sind, lediglich auf der Oberfläche des Wassers ihr Leben zu führen, sondern hat sie strenge geteilt, indem sie die einen als Wassertiere ihre freie Bewegung zwischen Oberfläche und Grund der See, die anderen als Lufttiere zwischen der Wasseroberfläche und dem Äther angewiesen erhielten ... Der Einwurf, es gebe fliegende Fische und tauchende Vögel, fällt von selbst, sobald die Frage des ständigen Verhaltens dieser Tiere zu den kleinen Ausschreitungen ihrer Fähigkeiten aufgeworfen wird; es ist diese erweiterte Ausrüstung ihrer Bewegungsfähigkeit ein Naturspiel, aber kein absolutes Bedürfnis für dieselben und uns. Alle Seetiere, von der Qualle bis zum Walfisch, entziehen sich bei Eintritt des Sturmes der schlagenden Wirkung der Wellenbewegung, weil diese auf ihren Mechanismus erschütternd und schädlich einwirken würde ... Nur der Mensch als schaffender Geist versucht, die von der Natur nicht sehr benützte Oberfläche der See zu seinem Arbeitsfelde zu erheben. Er schuf schwimmende Schiffe und vertraute diesen seine Werte im Handel und Leben; - aber schwach, wie er selbst, hinkt sein Machwerk nur langsam dem Naturbild nach, es ist der Spielball der Wellen und des Windes, es ist kaum eine Sandkorngröße den Gewalten der Natur gegenüber, es zerstäubt am Felsenriff wie Meeresschaum und doch ist es trotz all seines Nichts und seiner Gebrechlichkeit eine menschlich große werte Schöpfung. Doch wie der Geist des Menschen sich höher und höher schwingt, so dringt er auch immer tiefer ein in die Naturkräfte der Tiere wie der Welten. Ich bin in diesem Drange zunächst den Seetieren gefolgt und fand, dass es möglich sei, durch die heutigen Mittel der Technik ein von Menschen beseeltes Gebäude zu schaffen, welches uns gestattet, gleich dem Fisch der sturmgepeitschten Woge und ihren Schlägen uns zu entziehen; ich fand, dass es möglich sei, dieses von Menschen beseelte Tier in allen Richtungen auf und unter der Oberfläche des Wassers zu bewegen und wagte es, das schwächlichste Geschöpf der Welt zur Ausbildung und Erstarkung, dem Freund zu Wehr und Nutz, dem Feind zu Schad’ und Trutz’ zu übergeben.“
Doch die monarchische Welt von damals hatte es nicht gewollt. Der Voraussicht Bauers wurde man erstmalig gewahr, als Professor Whitelaw vom Virginia Institute auf der Underwater Technology Conference in Colorado in den sechziger Jahren das Konzept eines Seegütertransportes unter Wasser vortrug. Nach seinen Worten kann an die Konstruktion von „Nuklear-Aalen“, den UW-Frachtschiffen, mit 427 Meter Länge schon heute gedacht werden. Sie sollten 40 Knoten bei Tiefen von über 60 Meter zurücklegen, vermögen eine Nutzlast bis zu 5000 Tonnen zu tragen und würden den herkömmlichen Transportverfahren überlegen sein. Das moderne hochtechnisierte Zeitalter erst könnte die Verwirklichung einer über 100 Jahre alten Idee, eines Planes von Wilhelm Bauer ermöglichen.
Heute am Anfang des neuen Jahrtausends und weitere 40 Jahre nach jener Konferenz wissen wir, auch die derzeit modernste Variante eines UW-Frachtschiffsverkehrs wäre zwar technisch machbar, rechnet sich aber nicht! Abgesehen von der zusätzlichen Problematik des weiteren Anhäufens nuklearer Abfälle. Technische Visionen und kaufmännische Realität waren schon oft zwei verschiedene Paar Schuhe.
Doch das konnte Bauer nicht wissen, als er im Juli des Jahres 1863 auf dem Deck des Dampfschiffes Delphin stand. Er starrte in die unruhigen Wasser des Bodensees. Wellen kamen auf. Sollte der alte Taucherfeind Wind wieder dazwischen fahren wie bei seinem ersten Versuch? Die Umrisse des Wracks waren da schon an der Oberfläche sichtbar, als ein schweres Unwetter losschlug. Wellen schlugen die tragenden Fässer aneinander und zerschmetterten sie. Der Postdampfer Ludwig, gesunken nach einer Kollision mit dem Dampfer Zürich am 11. März 1861, glitt erneut hinab in die Tiefe. Wie lachten da die Spötter. Jetzt musste es gelingen. Sonst war alles zu Ende. Oh, er vergaß nichts. Mit dem Wrack stiegen die Bilder vergangener nutzloser Jahre aus den dunklen Gründen, wo sie schlummerten.
nach oben
134 erfolgreiche Tauchfahrten mit dem russischen Seeteufel, die Ernennung zum Kaiserlichen Submarine-Ingenieur im Rang eines Majors, die allerdings nicht sehr geglückten Unterwasser-Daguerretypien, Luftverbrauchsversuche, Unterwassernavigation, Arbeiten an einer unterseeischen Korvette und an der Konstruktion eines „Luftrepulsionsmotors“, die Intrigen gegen ihn, Fedorowitsch, der den Seeteufel stranden ließ, seine Heirat, Sophie und der Abschied von Russland - das alles lag hinter ihm, als er sich in München, in der Theresienstraße mit seiner jungen Frau niederließ. Er lebte von dem bescheidenen Vermögen, das ihm seine Tätigkeit in Russland eingebracht hatte. Die Tage und Monate verflossen. Still war es um den knapp fünfunddreißigjährigen geworden. Man hatte in den Zeitungen über ihn gelesen, umgeblättert und vergessen. Andere wurden als Erfinder des Tauchbootes gefeiert. Bauer verfasste kurze Berichtigungen. Sie erschienen nicht - bis auf eine, im „Freischütz“. Daraufhin erhielt er Besuch aus Bamberg, von einem Herrn Dr. Hauff.
Hauff hatte sich schon früher für Bauers Ideen eingesetzt und versuchte nun, Bauers Interesse für eine Publikation seiner Arbeiten zu wecken. Bauer lehnte ab. Zu oft war er enttäuscht worden. Aber war es nicht wieder ein Lichtblick, ein Strohhalm? Sollte es nicht doch möglich sein, dass es irgendwo in diesem Land jemanden gab, der seinen Ideen weiterhelfen konnte, sein beseelbares Seetier wieder auferstehen zu lassen? Bauer erläuterte seine Pläne und Konstruktionen. Im Frühjahr 1859 erschien in der Buchnerchen Verlagsbuchhandlung die Broschüre: „Die unterseeische Schifffahrt, erfunden und ausgeführt von Wilhelm Bauer, früher Artillerie-Unteroffizier, später kaiserlich-russischer Submarine-Ingenieur. In geschichtlicher und technischer Hinsicht auf Grund authentischer Urkunden und Belege dargestellt und mit Andeutungen über weitere Erfindungen Bauers versehen“ von Ludwig Hauff.
Nur gering war ihre Verbreitung und doch fanden sich neue Freunde. Der Unentwegteste unter ihnen wurde der Redakteur Friedrich Hofmann aus Leipzig. Doch zunächst geschah nichts Wesentliches. Bauer ließ sich im Strom der Hoffnungen treiben, ungeduldig, voll Unrast und doch ohnmächtig. Er vervollkommnete seine Pläne für Schiffshebeverfahren, beschäftigte sich mit der Konstruktion von Flugmaschinen, griff andere Pläne wieder auf. Allein, nichts geschah und Bauer wartete.
Endlich, im Jahr 1861, löste eine Depesche die Spannung. Eine bayrische Dampfschifffahrtsgesellschaft, die von seinem in England patentierten Hebeverfahren mit so genannten „Kamelen“ gehört hatte, bat ihn den bei Nacht und Nebel gesunkenen Postdampfer Ludwig zu heben. Bauer willigte ein - unter sehr ungünstigen Bedingungen. Vergeblich hatte er gehofft, dass der bayerische Staat sich seiner Erfindung annehme. Die gesamte Summe, die Bauer gegen Hinterlegung einer Kaution von 1000 Gulden geboten wurde, reichte nicht einmal für die Herstellung der Hebekamele, geschweige denn der Taucherkammer. Aber Bauer musste zugreifen. Zulange hatte er in der Enge seines Zimmers gesessen, wo das Tageslicht nur als blasser Streif über die dunklen Tapeten huschte. Es drängte ihn zur Tat, ans Wasser, in die Tiefe. Dann mussten eben Fässer die Kamele ersetzen und Taucher die Taucherkammer. Bauer reiste kurz entschlossen nach Rorschach am Bodensee.
nach oben
Dort angekommen, heuerte er als erstes eine Mannschaft an, um sie als Taucher auszubilden. Von acht Männern erwiesen sich nur drei als geeignet. Aber auf diese konnte er sich dann auch verlassen. Jetzt kam ihm seine weiterentwickelte Tauchausrüstung zu Gute. Zwar hatte Bauer schon von einem gewissen August Siebe gehört, der in London ein neuartiges Helmtauchgerät konstruiert haben sollte, doch waren diese Geräte nicht zugänglich. Also stellte er sein eigenes System zusammen. Der Taucher steckte dabei in einem 26 Pfund schweren Anzug aus Leinen und Kautschuk. Der nicht mit dem Anzug verschraubte Taucherhelm aus Kupfer reichte bis über den oberen Teil des Brustkorbes. Die zum Taucher hinabgepumpte Luft strömte über die Helmunterkante ab. Gehalten wurde der Helm von einem so genannten Reiteisen. Rasch abwerfbare bleierne Ringe von 86 Pfund sorgten für den nötigen Abtrieb. Das ganze funktionierte also nach dem Tauchglockenprinzip.
Bauer stieg als erster hinab, obgleich ihn wieder Gicht und Rheuma plagten - ein altes Leiden, das er sich bei den Tauchversuchen in dem Eiswasser der Newa zugezogen hatte. Doch er musste es sehen, das Schiff. Der Mann an der Winde zog ein Haltetau an. Der Ladebaum schwang aus. In einem Schwall von Luftblasen versank Bauer in die Tiefe. Er blieb nicht lange unten. Es waren kaum zehn Minuten vergangen, als der Signalgast drei lange Züge registrierte. Auf! Bauer war totenbleich, als man ihm den Helm abnahm. Hofmann beschrieb später, was die Taucher da unten sahen:
„In unheimlicher Dämmerung lag das Schiff mit gebrochenem Schlot und mit dem Hinterteil tief eingesunken. Auf dem Verdeck stand ruhig die Ladung, angebundene Tiere, Pferde und Ochsen, schwammen auf dem Schiff und an den Seiten desselben; endlich drang man zu den Kajütenfenstern hinan; ein Blick hinein erfüllte alle mit Grauen. Da lagen die Armen, die ein schrecklicher Augenblick vom Leben getrennt, auf dem Boden umher, Männer und Frauen, starr und unbewegt, wie in einem großen geschlossenen Sarge. Als aber die Taucher zur anderen Seite des Schiffes kamen, erschütterte sie ein entsetzlicher Anblick: ein Frauenantlitz sah mit weit offenen Augen zum aufgerissenen Kajütenfenster heraus, wie noch jetzt nach Hülfe flehend; so war die Unglückliche im Tode erstarrt.“ Dennoch ging Bauer mit seinen Tauchern rüstig an die Arbeit. Fässer wurden hinabgesenkt, hinter Luken und Fenstern verankert und durch Feuerwehrspritzen mit Luft gefüllt. Nach dem so 27 Fässer angebracht waren, hob es sich etwas vom Lehmboden ab. Der Erfolg konnte nicht ausbleiben. Und bald schwamm das Schiff dicht unter der Oberfläche. Man wartete noch auf den Schlepper, als jenes Unwetter losbrach.
Noch zweimal hob Bauer das Schiff, am 7. und am 23. Juni 1861. Doch dieses Mal scheiterte es an der Verwahrlosung der Schleppfahrzeuge. Bauer gab auf. Was hatte ein Rorschacher Bürger zu ihm gesagt? Die bayerische Regierung wäre an der Bergung überhaupt nicht interessiert, sie wolle nur die Gemüter der Angehörigen beruhigen und im übrigen ihr Geld hübsch fein für den neuen Dampfer sparen? Bauer wütete. Nichts sprach gegen sein neues Hebeverfahren. Es lag an dem Wollen eines Häufleins Bürokraten und Pfeffersäcken. Man sabotierte ihn. Er ballte die Fäuste, unbewusst. Nun gut, die erste Runde war verloren, aber man würde sehen.
nach oben
Bauer ahnte, was nun vorerst kommen würde. Deshalb ließ er sich von 30 der angesehensten Männern unter den Zuschauern ein Zeugnis ausstellen: „Sie bestätigen ferner, dass die Ludwig mit den an dem Schiffskörper befestigten circa 50 Tragfässern durch das Dampfschiff Stadt Lindau von der Hebungsstelle circa 800 Schritte gegen das Land bugsiert wurde, somit die Hebung und Transportmöglichkeit in anschaulichster Weise sich praktisch bewährte und nehmen deshalb keinen Anstand zu bezeugen, dass Herr Bauer eine Hebemanier durchführte, welche keinen Zweifel darüber lässt, dass Schiffe jeder Größe ohne Schadennahme durch diesen Hebeprozess samt Ladung gehoben und geborgen werden können. Rorschach, 22. August 1861.“ Es folgen die Unterschriften. „Die Echtheit der vorstehenden Unterschriften beurkundet, Rorschach, den 30. August 1861, Bezirksamtmann Boppart.“
Dennoch - die Ufer des Bodensees hallten wider von dem Gelächter der Neider. Ein gelungenes Thema für Witzblätter: „Der Wilhelm konnt’ den Ludwig nicht vergessen, fiederallala ...“ Gut war es, in jenen Tagen auch Freunde zu haben. Vor allem die Herren Hauff und Hofmann. Letzterer, Mitarbeiter der demokratisch gesinnten „Gartenlaube“, begann noch im selben Jahr mit einer Beitragsfolge über Wilhelm Bauer. Harte Worte fand er für die Besserwisser, ja er drohte: „Jede Erfindung hat ihre Geschichte, aber wenige werden von dem besonderen Interesse sein, welche fast jede der Bauer’schen Erfindungen auszeichnet - durch die Persönlichkeiten, welche im Schicksale derselben eine Rolle spielen. Diese Geschichte wird noch geschrieben und ich glaube, das reichste Material dazu zu besitzen. Es steht darin mancher große Herr in nicht besonderem Glanze.“
Aber nicht nur Worte waren es, die den rührigen Mann auszeichneten. Er gründete ein Komitee zur Unterstützung des deutschen Taucherwerkes, zur Unterstützung Wilhelm Bauers. Ein Aufruf erschien, der auch um freiwillige Spenden bat. Wenn jeder Leser der „Gartenlaube“ sich entschlösse nur drei Silbergroschen zu senden, hieß es, so würde diese Summe genügen, um die Hebekamele, Luftpumpen, Schläuche, Tauchausrüstungen usw. herzustellen. Gelder kamen ein. Bauer schöpfte Mut. Mitte Juli 1862 begann er, seine Hebekamele zu bauen. Das waren jene großen Ballons, die am Schiffskörper befestigt und mit Luft gefüllt werden sollten. Der amerikanische Bürgerkrieg hatte jedoch die Kautschukpreise in die Höhe schnellen lassen. Also hieß es sparen, konnten die leinernen Ballons nur mit einer Kautschuklösung gedichtet werden. Kein gutes Omen.
Wohl hatte er durch die Unterstützung einer am nationalen Sammelwerk beteiligten Bremer Firma endlich zwei nach seinen Entwürfen verbesserte Luftpumpen bekommen. Diese vermieden durch eine besondere Ausbildung der Kolben und Zylinder die durch die Kompression herrührende Erwärmung der Ledermanschetten und Dichtungen. Doch es war wie immer. Wieder schien sich alles gegen Bauer verschworen zu haben, angefangen bei der bayerischen Landesregierung, die plötzlich die Hebung verbieten wollte, bis hin zum Wetter. Durch die unerwarteten Widerstände verzögerte sich die Hebung. Die Zeit der Herbststürme rückte heran. Als sich dann noch ein Hebeballon losriss, entschied Bauer am 7. November, die Bergungsversuche einzustellen.
nach oben
Wie vergingen Monate. Der Frühling fuhr mit dem Föhn von den Bergen herab. Dann wurde es Sommer und endlich, endlich erschien wieder die Silhouette der Ludwig. Man schrieb den 21. Juli 1863. Die Lokomobilen pumpten seit dem frühen Morgen. Gegen 9 Uhr tauchte das Heck des Schiffes auf und um halbzehn betrat Obertaucher Schroff das Heck der Ludwig. Der Uhrzeiger rückte gegen Mittag. Der Radkasten durchstieß die Wasseroberfläche. - Da schob sich vom Untersee ein dicker schwarzer Strich heran. Wind kam auf. Schaumige Wellenkatzen huschten herbei. Bauer starrte immer noch in das dunkele Wasser des Bodensees. Jetzt galt es. Er gab das Zeichen. Ein Böllerschuss verkündete die Hebung und den Abtransport. Um halbdrei kam der Schlepper Wilhelm längsseits. Kommandos hallten von Schiff zu Schiff. Schroff angelte aus der Kajüte der Ludwig eine unversehrt gebliebene Flasche Kognak. Sie wanderte reihum. Gegen 17 Uhr setzte sich der Tross in Bewegung.
Im Dämmer des Abendlichtes stieß die Ludwig auf Land. Brausender Jubel der am Rohrschacher Ufer dicht an dicht stehenden Menschen ertönte. Schiffssirenen heulten auf. Salutschüsse rollten über das Wasser. Bauer schien alles nicht mehr zu hören, sondern blind und stumm in sich hineinzuhorchen. Jedoch, in Wirklichkeit, war er schon wieder ganz woanders, sah voraus. Neue Pläne, neue Arbeit! Endlich fühlte er sie wieder, die erste Sprosse jener Leiter, die zum Erfolg führte. Verschiedene Reeder erkannten den geschäftlichen Wert der Erfindung und unterbreiteten Bauer Angebote. Im Bremen beschlossen einige reiche Kaufleute die Gründung einer Aktiengesellschaft für Schiffshebung.
Da brach der Krieg aus. 1864 marschierten preußisch-österreichische Truppen in Schleswig ein. Alle Pläne, die eine Festlegung größerer Kapitalien auf längere Sicht nötig machten, zerschlugen sich. Deutschlands Taucherwerk - unermüdliche Arbeit Bauers, Einsatz der Taucher Schroff, Hoch und eines dritten, der ungenannt blieb, ein modifiziertes Tauchanzugmodell, verbesserte Luftpumpen, Tauchersignale, mehrere Hebeversuche, ein geborgenes Schiff - dabei blieb es in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland.
Und Wilhelm Bauer? Wieder einmal, wie immer, hatte er schon an der offenen Tür gestanden. Aber sie ist dicht vor ihm zugefallen. Wie immer. Für immer. Nach einem heftigen Gichtleiden, das ihn sechs Jahre ans Bett fesselte, starb er einsam und verarmt im Juni 1875.
nach unten
nach oben
1864 und später:
Vormarsch der Tauchfahrzeuge
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das sportliche Tauchen einen gewaltigen Aufschwung. Das autonome Presslufttauchgerät bot die technischen Voraussetzungen. Die Schlüsselfiguren jenes Beginns waren Hans Hass und Jacques-Yves Cousteau. Der Wiener Zoologe Hans Hass führte bereits in den vierziger Jahren das Schwimmtauchen als Forschungsmethode in die biologischen Wissenschaften ein. Er benutzte damals noch ein (den Taucher leicht gefährdendes) Sauerstoff-Kreislauftauchgerät. Die Unternehmen von Hass begleitete eine rührige Publicity in Form von Presseberichten, Filmen und Büchern. Schon in den fünfziger Jahren schnallten sich - von Hass und Cousteau animiert - Tausende und aber Tausende das Presslufttauchgerät auf den Rücken, um die Wunder der Tiefe zu bestaunen. Die Unterwasserwelt wurde „fashionable“. Doch nicht alle Interessenten konnten selbst tauchen; sei es aus gesundheitlichen Gründen, sei es, weil man Unbequemlichkeiten oder Haie befürchtete. Die Folge: In Lagerschuppen, Hinterhofwerkstätten, Garagen und allerlei obskuren Orten schlosserten überwiegend Amateure eine ganze Armada einfachster Ein- und Zweimann-Tauchfahrzeuge zusammen. Die allgemeine Wirtschaftskonjunktur begünstigte diese Situation. Und schließlich lenkten auch die als Sensation aufgemachten Meldungen über die Bathyskaphe die Aufmerksamkeit der staunenden Öffentlichkeit auf nichtmilitärische Tauchfahrzeuge.
nach oben
Die meisten Boote waren sehr einfach konstruiert. Ein von Bleiakkumulatoren und einem Elektromotor angetriebener Heckpropeller sorgte für den Vortrieb. Manövriert wurde über Seiten- und Tiefenruder. Je ein Wassertank oder eine spezielle Sektion im Bug und Heck dienten zur Regelung des Trimms und Auftriebs. Zum Atmen begnügte man sich mit der im Druckkörper befindlichen Luft. Ab und zu ließ der Pilot aus einer kleinen Druckgasflasche Sauerstoff in den Raum fließen. Kohlendioxidabsorber fehlten oft, entsprechende Messgeräte immer. Einsetzender Kopfschmerz und steigende Atemfrequenz signalisierten nachdrücklich genug, dass die zulässige Tauchzeit schon etwas überzogen sei. Die Boote tauchten - wenn überhaupt - meist nur einen Sommer. Dennoch war diese letzte Epoche der Bastler in der Tauchfahrzeughistorie bedeutsam: Sie lenkte das Interesse der allzeit nach Marktlücken spähenden Industrie auf kleine Tauchfahrzeuge. Bald erschienen die ersten industriell gefertigten Sporttauchboote auf dem Markt: in den USA die Amersub 300 (1961), in der Bundesrepublik die auch in den USA angebotenen S-Typen der Bremer Firma Eschholz (S-24, SM-64), die von Hagenburg und die Tigerhai (1963) der Firma Silverstar. Diese Fahrzeuge waren etwa drei bis sechs Meter lang, besaßen eine Masse von einer Tonne, waren äußerst spartanisch ausgerüstet und kosteten etwa soviel wie ein Mittelklasse-PKW.
nach oben
U-Boote auf Angriffskurs
Schon immer wurde ein Großteil der Tauchfahrzeuge für militärische Einsätze entwickelt. Freilich: Bei manchen Konstruktionen vergangener Jahrhunderte entsteht leicht der Eindruck, der Erfinder habe das Boot nur zum Schein als Waffe deklariert, um eher Finanziers zu finden. Mit kriegstechnischen Entwicklungen waren schon immer Schatullen und Banktresore leichter zu öffnen als mit, wie Papin es ausdrückte, „Geschäften des Friedens“ - sei es eine gefährlichere Holzkeule oder eine neue Kernwaffe. Die frühen Boote pflegten jedoch gewöhnlich nur die Insassen zu gefährden, nie aber den Gegner.
Diese Situation änderte sich erstmals während des amerikanischen Bürgerkriegs. Am 17. Februar 1864, kurz vor 21 Uhr, sichtete der diensthabende Decksoffizier Crosby in 90 Meter Entfernung ein sich direkt auf das Dampfschiff USS Housatonic zu bewegendes Objekt. Crosby: „Es sah wie eine vom Wasser bewegte Planke aus!“ Er gab aber vorsichtshalber Alarm, ließ den Anker hieven und mit voller Kraft zurückfahren. Alle Mann stürzten an Deck. Zu spät. Bereits zwei Minuten nach der ersten Beobachtung rammte die H. L. Hunley den Torpedo mittschiffs in den Dampfer. Der Spierentorpedo explodierte. Die Housatonic sank sofort. Die Besatzung flüchtete sich auf die nach dem Untergang noch aus dem Wasser ragenden Masten. Erst am nächsten Morgen wurden sie gerettet. Fünf Mann blieben vermisst. Aber auch an den Kais von Charleston warteten die Konföderierten vergeblich auf die Rückkehr der H. L. Hunley. Erst bei der einige Jahre später erfolgten Hebung der Housatonic fanden Taucher das Tauchfahrzeug. Es lag 30 Meter von dem Schiff entfernt. Sein Bug war noch immer auf den Feind gerichtet. Mit 20 Kilogramm Schießbaumwolle und einem prächtigen Knall endete also 1863 jäh die Epoche ausschließlich harmloser Tauchfahrzeuge.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überschwemmten Tauchfahrzeugkonstruktionen die Marinebüros - durch die enorm gewachsenen technischen Möglichkeiten wie der Erfindung der Dynamomaschine und der Verbrennungsmotoren, sowie durch die Industrialisierung. Geheimrat Busley berichtete 1900, dass „... der früheren preußischen, dann norddeutschen und jetzigen deutschen Marine nach Ausweis ihrer von mir durchforschten Akten vom Jahre 1861 ab bis heute nicht weniger als 181 verschiedene Unterseeboote zur Ausführung angeboten worden sind“. Und das in nur einem Land! - Die Historie der U-Boote, der militärischen Tauchfahrzeuge, ist aber nicht unsere, sondern schon wieder eine ganz andere Geschichte.
nach oben
Forschungstauchfahrzeuge
Bis in die sechziger Jahre unseres Jahrhunderts bildeten Tauchfahrzeuge für Forschungen und Unterwasserarbeiten die regelbestätigende Ausnahme: 1929 baute der Japaner I. Nishimura ein nur für Fischereiforschungen und Inspektionen bestimmtes Tauchboot, von dem in Europa aber nichts weiter bekannt wurde. 1931 versuchte der Amerikaner Wilkins mit einem von der U. S. Marine ausgemusterten U-Boot den Nordpol zu erreichen. Er hatte es zu einem Forschungsfahrzeug umbauen lassen. Das Vorhaben scheiterte, glücklicherweise jedoch ohne Verluste an Menschenleben.
Die Bathysphere von Barton und Beebe war kein Tauchfahrzeug. Dennoch ist ihr Einsatz 1934 in der Tiefe von 923 Meter - eines der bemerkenswertesten Forschungsvorhaben und ein so wichtiger Meilenstein beim Vorstoß in die Tiefe gewesen, dass ihr Wirken in keiner „Unterwasserhistorie“ fehlen darf.
Mit der Konstruktion des ersten Bathyskaphen der Geschichte begann der Schweizer Professor Auguste Piccard kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Das erste Bathyskaph hieß F.N.R.S.-2. Es lief 1948 vom Stapel, wies zahlreiche Mängel auf und kam nicht über einen unbemannten Abstieg auf 1380 Meter und einen bemannten auf 25 Meter hinaus. Anfang der fünfziger entstanden zwei weitere Bathyskaphe, in Frankreich die FNRS 3 und in Triest die Trieste. Am ersteren arbeitete A. Piccard als Berater mit, das andere entwickelte er selbst - assistiert von seinem Sohn Jacques. Beide Fahrzeuge liefen 1953 vom Stapel. 1960 erreichte die von der U.S. Navy gekaufte und modifizierte Trieste im Marianengraben die bisher größte Tiefe: 10 916 Meter. 24 Jahre später, im Frühsommer 1984, ermittelten japanische Wissenschaftler die tiefste Stelle des Marianengrabens. Sie liegt nur acht Meter tiefer als die von den Piccards ermittelte Tiefe!
Jacques-Yves Cousteau hatte sich bereits 1951 geschworen, ein kleines bewegliches Tauchfahrzeug in Dienst nehmen zu wollen. 1955 legte er mit seinen Mitarbeitern die Grundkonzeption fest. 1959 wurde es erstmals getestet. Auch in der ersten Hälfte der Achtziger Jahre absolvierte dieses Boot, die SP 300 (bzw. SP-350, denn später wurde die zulässige Maximaltiefe auf 350 Meter erhöht), noch so manche Tauchfahrt. Die SP 300 und die Trieste sind sicher die bekanntesten zivilen Tauchfahrzeuge der Welt.
Anfang der sechziger Jahre ließ der Zeitungsmagnat und begeisterte Sporttaucher John Perry seine ersten Fahrzeuge vom Stapel: PC-3X (1961), PC 3A-1 (1962), PC-3B (1963). Als jenes Jahrzehnt zu Ende ging, war Perry der erfolgreichste Hersteller kommerzieller Tauchboote.
Bereits der Einsatz der relativ unbeweglichen Bathyskaphe zeigte, dass sich mit Tauchfahrzeugen so manches Problem der Meereskunde besser erforschen ließe. Schon während der 5. bis 10. Tauchfahrt der Trieste im Oktober 1956 im Tyrrhenischen Meer, befand sich der Wissenschaftler Pollini als Beobachter an Bord. Im Jahr darauf bekundete auch die U.S. Navy Interesse an Einsatzmöglichkeiten der Trieste. Das Office of Naval Research schloss einen Kontrakt mit Auguste Piccard über eine Serie von Tauchfahrten. Erstmals hatten, von William Beebe und seinen Begleitern abgesehen, amerikanische Wissenschaftler Gelegenheit, sich auch in größeren Tiefen „in situ“ mit Unterwasserforschungen zu beschäftigen. Obwohl die Trieste eigentlich für derartige Einsätze ein recht ungeeignetes Fahrzeug ist, waren sich Ende 1957, nach 22 Abstiegen, die Fachleute einig, dass ein solches Bathyskaph der meereskundlichen Forschung wesentlich weiterhelfen würde.
Nicht umsonst auch gelang es Mitte der fünfziger Jahre dem sowjetischen Allunions-Institut für Seefischerei und Ozeanographie, den Militäradministrationen überzeugend nachzuweisen, dass man ein U-Boot brauche, um die für die Nahrungswirtschaft wichtige Heringsforschung auf höherem Niveau weiterfahren zu können. Der Um- und Ausbau des von der sowjetischen Kriegsmarine eigens ausgemusterten Bootes erfolgte 1957/58. Die ersten Forschungsfahrten der Severyanka begannen 1959 und führten in die Barentssee und in den Nordatlantik.
In den folgenden Jahren entwickelte sich das Tauchfahrzeug zu einem nützlichen, wenn auch kostspieligen Instrument wissenschaftlicher Forschung. Seine Vorteile basieren vor allem auf Sachverhalten, die sich aus der direkten Anwesenheit des Menschen im Meer ergeben:
Tauchfahrzeuge ermöglichen eine unmittelbare visuelle Beobachtung, die auch durch die besten Fernsehanlagen und optischen Aufzeichnungsgeräte nicht möglich ist. Die Beobachtung ist besonders für die biologische Forschung von Bedeutung. Ein Vergleich mag deren Wichtigkeit verdeutlichen: Man stelle sich vor, wie es um das Wissen der Fauna eines beliebigen Landstrichs aussähe, wenn er nur nach dem beurteilt würde, was sich zufällig in von Flugzeugen herabgelassenen Netzen verfinge oder was auf dem Fernsehbildschirm erschiene. Aber auch dem kundigen Auge des Geologen vermag allein schon die optische Begutachtung der Bodenstrukturen etliche aufschlussreiche Informationen zu liefern. Gewisse Maßnahmen können unmittelbar vor Ort getroffen werden, wie fotografische Aufzeichnungen und Probennahme, sowie entsprechende Auswahl und Entscheidung. Die zu bergenden Objekte oder zu nehmenden Bodenproben können gezielt ausgesucht werden. Besitzt das Fahrzeug eine Taucherluke, so kann der Wissenschaftler in geringen Tiefen sogar selbst aussteigen oder einen Taucher entsprechend dirigieren, um weitere zweckdienliche Aktionen zu unternehmen. Forschungsgeräte können direkt installiert und kontrolliert werden, der Versuchsaufbau ist leichter zu ändern, eventuell können sogar Reparaturmöglichkeiten vor Ort vorgenommen werden.
Vor allem diese drei Möglichkeiten waren es, die besonders in der ersten Hälfte der sechziger Jahre eine Reihe von Meeresbiologen und -geologen in helle Begeisterung über die Möglichkeiten von Tauchfahrzeugen ausbrechen ließ.
nach oben
Homo Aquaticus?
Die erste Hälfte der sechziger Jahre lässt sich vielleicht auch als die Epoche der „Unterwasser-Euphorie“ bezeichnen. Umfangreiche und weltweit betriebene meereskundliche Untersuchungen und Bestandsaufnahmen besonders 1957 im Rahmen des Internationalen Geophysikalischen Jahres hatten so manchen Wissenschaftler schlussfolgern lassen, dass das Meer eine fast unerschöpfliche Schatzkammer sei, wohlausgestattet mit Nahrung und Rohstoffen für Jahrhunderte. Es ist schwer abzuschätzen, was damals Ursache und was Auswirkung war und inwieweit sich die verschiedenen Faktoren gegenseitig beeinflussten: Wissenschaft und Technik nahmen einen enormen Aufschwung, die so genannte technologische Revolution.
Das Wissen über das Meer wuchs rapid. Die oberflächennahen Seegebiete waren nun mit Presslufttauchgeräten und den ersten zivilen Tauchfahrzeugen relativ leicht zugänglich. Man unternahm auch verstärkte Anstrengungen in der „Unterwasser-Aufrüstung“, d. h. es wurden vor allem mehr, bessere und tiefer tauchende U-Boote, neue Kernkraft-U-Boote und unter Wasser startende Raketen entwickelt. Und damit im Zusammenhang erhielten auch Meereskunde und Unterwasserforschung neue Prioritäten.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Noch 1968 klagte beispielsweise Kapitän Hendrix, Kommandant eines kernkraftgetriebenen U-Boots, er befände sich in der Lage eines Piloten, der über die Rocky Mountains fliegt, aber nicht wisse, wie hoch deren höchste Gipfel sind noch wo sie sich befinden. Nur die genaue Kenntnis der Ozeane, ihrer Topografie, Strömungsverhältnisse und Wasserschichtungen, der Schallausbreitung und anderer Faktoren gestattet den U-Boot-Befehlshabern eine sichere Navigation oder etwa ein „Verstecken“ hinter schallreflektierenden Wasserschichten, um sich den Ortungsversuchen des Gegners zu entziehen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass ein großer Teil von Resultaten der Meeresforschung auch oder gar zuerst von entsprechenden Marinestäben ausgewertet wird.
Dazu gesellen sich zum anderen die zahlreichen militärtechnischen Aufgaben, angefangen von Erprobungen neuer Geräte, über die Bergung von Übungstorpedos und -raketen bis hin zur Installation submariner Überwachungs- und Versorgungssysteme.
Ein anderes Beispiel: Im April 1963 versank das Jagd-U-Boot Tresher bei Tauchversuchen im Atlantik. Der Tod von 129 Mann veranlasste die U. S. Navy ernsthaft der Frage nachzugehen, was im Fall von Havarien überhaupt für die Besatzung von U-Booten getan werden könnte. War doch die Tresher das dreizehnte U-Boot allein der USA, das in Friedenszeiten verlorenging. 522 Tote standen bereits auf den Verlustlisten. Eilends wurde eine Kommission zusammengestellt, die Deep Submergence Systems Review Group (DSSRG). Sie ermittelte, dass die Navy keine Möglichkeit habe, in gesunkenen U-Booten eingeschlossene Menschen zu retten, wenn die Fahrzeuge tiefer als 330 Meter lägen. Das war die Einsatzgrenze der antiquierten McCann-Rettungsglocke, die erstmals 1939 bei der Bergung von 33 Seeleuten aus dem in 73 Meter Tiefe liegenden amerikanischen U-Boot Squalus eingesetzt worden war. Ferner entdeckte die Kommission, dass die Mittel zur Lokalisierung in größeren Wassertiefen gesunkener Objekte äußerst primitiv und ihre Bergung nahezu aussichtslos war. 1964 wurde der von der DSSRG vorgeschlagene Plan zur Änderung dieser Situation angenommen und als separates Projekt innerhalb der meerestechnischen Aktivitäten der U. S. Navy bestätigt.
Wie gesagt: Anfang der sechziger Jahre begann die Zeit der „Unterwasser-Euphorie“. Tief- und Langzeittauchversuche lösten einander ab. In aller Welt entstanden Unterwasserstationen, in denen Taucher Tage und Wochen im Meer verbrachten. Neue Forschungsschiffe liefen vom Stapel. Die ersten komplexen und automatisch arbeitenden Datenerfassungssysteme, die ersten Meeresbodenfahrzeuge und Unterwasserbaumaschinen wurden konstruiert.
Es begannen Versuche mit Unterwasserfarmen, Experimente zur Gewinnung mariner Bodenschätze. Wissenschaftler präsentierten in Millionen und Milliarden Tonnen bezifferte Vorkommen zu allen möglichen Reichtümern des Meeres, die es nur zu bergen galt. Eine Flut von Sachliteratur erschien, die den nun anbrechenden Beginn der Eroberung und umfassenden Nutzung des Meeres verkündete. J.-Y. Cousteau schließlich postulierte den „Homo Aquaticus“, den Menschen, der sich künftig mit flüssigkeitsgefüllten Lungen ganz dem Leben im neuen, dem siebten Kontinent widmen würde. Welch eine glänzende Zukunft für Innovationen und Investitionen in einen ganz neuen Zweig der Technik, der Meerestechnik.
nach oben
Aufstieg und Fall
1964 glitten viele der berühmtesten zivilen Tauchfahrzeuge erstmals ins Wasser. Ihre Namen stehen in jeder Chronik: Aluminaut, Alvin, Asherah, Deep Jeep und Moray aus den USA, das erste Touristen-U-Boot Auguste Piccard aus der Schweiz und die mehr einem konventionellen U-Boot ähnelnde japanische Yomiuri.
Im folgenden Jahr, 1965, wurden drei neue Tauchfahrzeuge fertig: Die Deepstar 4000 in Teamwork zwischen Cousteaus Ingenieuren und Westinghouse, Perrys PC 3A-2 und die Pisces I. Letztere entstand in Kanada. Drei Berufstaucher hatten sich Anfang der sechziger Jahre gedacht, vielleicht könne ein Tauchboot noch mehr, als nur Waffen, Unterwasserfans und Wissenschaftler befördern. Mit einem Tauchfahrzeug müsste sich doch auch ein Teil ihrer Unterwasserarbeiten besser und sicherer erledigen lassen, zum Beispiel die Ausführung von bis dahin nicht durchführbaren Aufgaben. Sie gründeten in Vancouver eine kleine Gesellschaft, die International Hydrodynamics Company (HYCO). Von Anfang an achtete man bei der HYCO auf einfache, erprobte Konstruktionsdetails und ein Minimum an Kosten. Die Pisces I war etwa fünf Meter lang, besaß zwei kugelförmige Druckkörper (der achterliche beherbergte die Maschinenanlagen) und sie konnte mit drei Personen an Bord 610 Meter tief tauchen. Die Pisces I avancierte mit zu dem Prototyp kommerzieller (wie überhaupt erfolgreicher) Tauchfahrzeuge. Nur Boote dieses Typs mit über einem Dutzend Nachfolger behaupteten sich später im wesentlichen gegen die übermächtige Konkurrenz von Perry. Als Feuerwerk und Kirchenglocken das neue Jahr - 1966 - einleiteten, waren die meisten der für die kommenden zwei Jahrzehnte bedeutsamsten Tauchfahrzeugtypen und Konstruktionsprinzipien entwickelt.
Einen wesentlichen Meilenstein in der Tauchfahrzeuggenesis bedeutete weiterhin die Deep Diver, das erste zivile Tauchfahrzeug mit einer modernen Taucherkammer. Der amerikanische Erfinder E. A. Link konstruierte sie in Zusammenarbeit mit Perry. Auch Jacques Piccard als Initiator des 1968er Ereignisses - die Golfstromdrift der PX-15 - ist ein klingender Name aus jener Zeit.
Ende der sechziger Jahre wurden immer mehr und immer perfektere Tauchfahrzeuge fertig. Auf ihren Hüllkörpern standen berühmte Namen von großen Werften, Metallindustrien, Elektronikkonzernen, Luft- und Raumfahrtunternehmen. Sogar ein Automobiltrust war dabei: General Motors mit der Dowb. Wer nur irgendeine Möglichkeit sah, paradierte mit einem Tauchfahrzeug. Die Reichtümer des Meeres würden die Investitionen schon wettmachen.
Allerdings: Mit einer simplen Entwicklung ließ sich die Konkurrenz kaum ausstechen. So entstanden immer pompösere Konstruktionen, ja technische Wunderwerke. Diese Boote mit ihren präzis berechneten, hochwertigen Druckkörpern, den raffinierten Propulsionsanlagen und komplexen Hydrauliksystemen, mit ihren vielseitigen Trimm- und Regelanlagen, ihrer ganzen Elektronik in Form von Bordrechnern, Steuergeräten, akustischen Augen, Ohren und Mündern kosteten aber auch immer mehr. Schon waren Summen in Millionenhöhe nichts Ungewöhnliches. Die Deepstar 2000 kostete eine Million Dollar, die Dowb zwei, die PX-15 drei, die Beaver MK IV, die Sea Cliff und Turtle je vier Millionen Dollar. Im Juni 1967 lief die Deep Quest vom Stapel. Baukosten: rund fünf Millionen Dollar!
1968 erreichte die Tauchfahrzeugwelle mit dreizehn fertiggestellten Booten pro Jahr ihren vorerst absoluten Höhepunkt; darunter befand sich auch die Beaver MK IV, das erste speziell für Arbeiten der Offshore-Industrie gebaute Tauchfahrzeug. Das Jahr verging mit diversen Überprüfungen der fertigen Boote, Tauchtests, kleinen Umbauten und dem Erarbeiten von Einsatzrichtlinien. In meerestechnischen Fachzeitschriften (auch sie waren Neuschöpfungen) erschienen die ersten großformatigen Anzeigen mit Aufzählungen von vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der raffiniertes Boote; freilich gegen horrende Leihgebühren. Die Hersteller waren natürlich gezwungen, all die durch den Bau verschlungenen Gelder mit Zins und Zinseszins wieder hereinzubringen. Das bedeutete: Charterkosten von täglich mehreren tausend Dollar! Bald war eine ganze, nach frischem Lack duftende Flotte startbereit - und wartete vergeblich auf ihren Einsatz.
Eventuell in Frage kommende Industriezweige waren weder bereit noch in der Lage, die sehr hohen Chartergebühren zu zahlen. Auch den wissenschaftlichen Institutionen waren die Boote zu teuer und ihr Einsatz war durch mangelnde Orientierungsmöglichkeiten zu sehr den Zufällen ausgesetzt. Noch gab es keine Möglichkeiten einer exakten Ortsbestimmung und Vermessung unter Wasser. Transponder konnten erst Anfang der siebziger Jahre in das Navigationssystem der Tauchfahrzeuge einbezogen werden. „Die Ausflüge der perfektesten Maschinen“, meinten Riffaud und Le Pichon, „stellten nichts anderes dar als zufälliges Gefuchtel mit der Taschenlampe in der Nacht.“
Auch die Erdöl- und Erdgasindustrie besaß kaum Bedarf an Tauchfahrzeugen. Noch befanden sich die meisten Offshore-Anlagen in geringen Meerestiefen. Untersuchungen und Wartungen erledigten Taucher viel billiger. War doch einmal ein Boot erforderlich, etwa zur Besichtigung einer kilometerlangen Pipeline, benötigten die Inspektoren kein so teures, supermodernes Boot wie die Deep Quest. Das ließ sich genauso gut mit den preiswerten PC-3-Typen von Perry erledigen.
Somit blieb - in der westlichen Welt - nur noch die U. S. Navy, ihre diversen Laboratorien und jene wissenschaftlichen Institutionen, die sich die teuren Boote hätte leisten können. Doch auch hier flossen die Gelder Ende der sechziger Jahre spärlicher. Das Abflauen der Wirtschaftskonjunktur und die hohen finanziellen Belastungen der USA durch die Eskalation des Vietnamkriegs veranlassten den Kongress zu radikalen Sparmaßnahmen. Diesem Kurs fielen auch eine ganze Reihe von Tauchfahrzeugen und Forschungsvorhaben zum Opfer.
Das erste Waterloo der zivilen Tauchfahrzeuge geschah um 1969/70. Dutzende von Booten wurden außer Dienst gestellt, eingelagert, zum Verkauf angeboten sowie laufende Programme und Bauaufträge gestrichen. Schon bald überzog eine natürliche Patina - Staub, Rost und Möwengeklecks - die kurze, aber illusionsreiche Geschichte moderner teurer Tauchfahrzeuge.
nach oben
Im Reich der Eruptionskreuze
Die erste Tauchfahrzeugwelle unserer Zeit hatten europäische Avantgardisten ausgelöst: die Piccards und J.-Y. Cousteau. Und noch einmal war es die alte Welt, welche die Tauchfahrzeuge aus den roten Zahlen hob und ihnen zu neuem Glanz und vielen Einsätzen verhalf. Der Schlüssel hieß: Nordseeöl. Mitte der sechziger Jahre wurde es durch eine neue, effektivere Methode des Tauchens (dem so genannten Sättigungstauchen) möglich, die Offshore-Anlagen in immer größeren Tiefen einsatzbereit zu halten; denn nur die ständige Betriebsbereitschaft erlaubte eine Amortisation der Millionenobjekte wie Unterwasserinstallationen und Bohrinseln. In der Regel ist die Unterwassertechnik so konstruiert, dass sie sich von der Oberfläche aus installieren und bedienen lässt. Doch kaum vermeidbare Havarien erforderten ohne Taucher eine langwierige Demontage, Bergung und erneute Installation; diese unproduktiven Zeiten hatten große finanzielle Einbußen zur Folge. Erschwerend wirkt sich zusätzlich die Abhängigkeit der Offshore-Industrie vom Wetter aus. Das Zusammenwirken beider Faktoren - Havarien und Schlechtwetter - kann schließlich zum Verlust der teuren und schwer ersetzbaren Unterwasserausrüstung und zum völligen Stillstand der Bohrtätigkeit führen.
Taucher konnten nun defekte Anlagen oft schon am Grund reparieren oder auswechseln. Das bedeutete eine wesentliche Zeitersparnis. Auch bewahrte die regelmäßige Inspektion und Wartung meist vor größeren Schäden. Die Ölkonzerne erkannten deshalb sehr rasch, welchen Vorteil es bringt, ständig Taucher zur Hand zu haben. 1971 waren weltweit bereits 85 % aller Taucherdienste in irgendeiner Form in der Offshore-Industrie beschäftigt. Und diese etablierten sich nun mit dem Vorrücken von immer mehr Bohr- und Förderanlagen in immer tieferes Wasser, auch in der Nordsee. 1968 leistete beispielsweise die Ocean Systems Incorporation, einer der mächtigsten Taucherdienste, vor Norwegen bereits Routinearbeiten in 130 Meter Tiefe.
Doch die Einsatzbedingungen beim Tauchen in der Nordsee sind hart: meist raues, stürmisches Wetter, hoher Seegang, kaltes Wasser, große Tiefen, schlechte Licht- und Sichtverhältnisse, starke Strömungen. Gefordert wurden aber teils mehrstündige Arbeiten, das Überwachen tiefliegender Installationen und kilometerlanger Pipelines, ausgedehnte Bodenuntersuchungen und Vermessungen. - für Taucher eine harte, manchmal nicht lösbare Aufgabe. Erschwerend wirkte sich noch die horizontale Unbeweglichkeit der bei tieferen Taucheinsätzen unentbehrlichen Taucherkammern aus. Ließe sich da nicht ein Teil der Taucherarbeiten effektiver von Tauchfahrzeugen aus erledigen? Könnte sich unter diesen Bedingungen nicht ein kommerzieller Tauchbootservice lohnen?
Die Vickers Shipbuilding Group aus Barrow-in-Furness, die unter anderem britische U-Boote baute, hatte sich in der Zeit der Tauchbootkonjunktur in Kanada ein Fahrzeug bestellt: die Pisces II. Dazu kaufte Vickers einen 37 Meter langen Hecktrawler und baute ihn als Mutterschiff um. Es erhielt einen der Situation angepassten Namen: Vickers Venture (Wagnis). Mit selbst finanzierten Fahrten zur Personalschulung, Demonstrationen und mit einigen staatlichen Aufträgen ermöglichte Vickers der Pisces II die Fortführung ihrer Tauchoperationen. Vickers passte das Boot den Nordseebedingungen an. Die Eignung des Fahrzeugs sprach sich schnell herum. Ein Boot genügte dem emporschnellenden Bedarf bald nicht mehr. Die Erdölkonzerne konnten sich Tauchfahrzeuge leisten.
Im April 1972 gründete Vickers mit zwei Teilhabern die Vickers Oceanics Ltd. (VOL), die erste Gesellschaft für den kommerziellen Betrieb von Tauchfahrzeugen. Das Offshore-Geschäft lief prächtig an. Ende 1972 war die Pisces I bereits 200 Tage und die Pisces II 150 Tage im operativen Einsatz gewesen. Die VOL investierte weiter, besaß 1975 schon sechs Tauchboote, fünf Mutterschiffe und übernahm in Zusammenarbeit mit der Oceaneering International auch Dienstleistungen im Taucherservice bis in 300 Meter Tiefe.
Weitere Tauchfahrzeugbetreiber erschienen auf dem Offshore-Markt, darunter mit den meisten Booten die in Marseille ansässige InterSub S.A. 1975 hielten mindestens acht Firmen für den Nordseeraum bis zu 18 Tauchfahrzeuge bereit. Die Direktoren von Perry und HYCO strahlten. Hatten sie bisher in schöner Regelmäßigkeit Jahr für Jahr meist nur ein Boot produziert, schoss 1975/76 die Kurve ihrer Stapelläufe erneut steil empor. nach oben
Die Tauchfahrzeuge waren in der Offshore-Erdöl- und Erdgasindustrie vielseitig einsetzbar, beispielsweise für:
- Geologische Untersuchungen des Meeresgrundes, Probennahme und Kartierung,
- Beobachtungen, d. h. meist wurden Spezialisten zu den Unterwasseranlagen befördert, um Montagevorgänge, Havarien u. ä. begutachten zu lassen,
- Unterwasserarbeiten, die häufig in einfacheren Hilfstätigkeiten beim Aufbau und der Wartung von Produktionsanlagen bestanden wie dem Auswechseln von Ventilen etc.,
- Inspektion und Überwachung, vor allem für die Überprüfung der Lage und Dichtigkeit von Pipelines,
- Bergungen, Demontagen, Trennarbeiten, Legen von Sprengladungen, Befestigung von Bergungsseilen,
- Personentransfer, also Transport von technischem Personal und Material unter atmosphärischem Druck zu hermetisch abgekapselten Produktionssystemen am Meeresgrund oder die Taucher wurden unter Überdruck transportiert
- und den Taucherservice, d. h. Beförderung, Versorgung und Überwachung der Taucher vor Ort.
Nach kostspieligen Lehren, von denen die wichtigste vielleicht die ist, dass es keine „Universalboote“ gibt, sondern es ein auf die vorgesehene Aufgabe genau abgestimmtes Gesamtsystem sein muss, hatte die Industrie das Tauchfahrzeug wieder akzeptiert - wenigstens im 20. Jahrhundert!
nach oben
home
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Für
Bestellungen per E-Mail
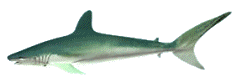
|


